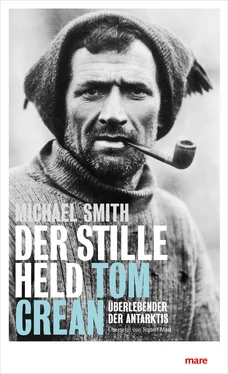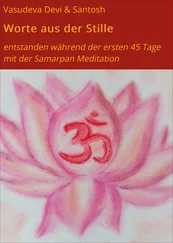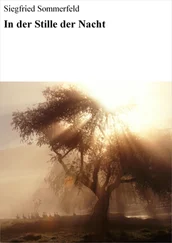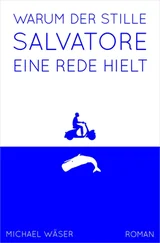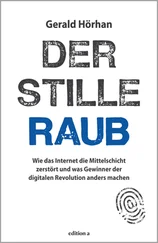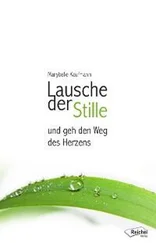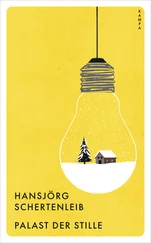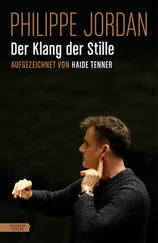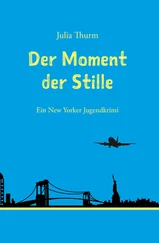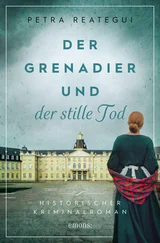Crean war durch nichts aus der Ruhe zu bringen und behielt in fast allen Situationen den Überblick. Trotzdem haftete ihm der Ruf an, Unfälle und Missgeschicke anzuziehen. Dabei blieb der Ire in der Regel auch dann gelassen, wenn es gefährlich oder gar lebensbedrohlich wurde, und das auf allen drei Expeditionen, an denen er teilnahm. Durch seine ganze Laufbahn hindurch finden sich Stimmen seiner Kameraden, die seine Freundlichkeit und seine Fähigkeit, im richtigen Moment ein Lied anzustimmen, in den höchsten Tönen loben. Ein Kamerad brachte es auf die Formulierung, Crean habe »das Herz eines Löwen«.
Die Discovery -Expedition war gewissermaßen Creans Lehrzeit, und es steht außer Frage, dass er ohne die Erfahrungen, die er in jungen Jahren machte, nicht jene Rolle in der Geschichte der Polarforschung hätte spielen können, die ihm durch die Beteiligung an den späteren Reisen zukommt. Sowohl Shackleton als auch Scott erkannten frühzeitig die besonderen Fähigkeiten des Iren, und beide nahmen ihn auf späteren Reisen in die Antarktis wie selbstverständlich mit.
Auf ihrem provisorischen Liegeplatz war die Discovery mit Eisankern gesichert. Um das Schiff davor zu bewahren, vom Eis zerdrückt zu werden, blieben die Kessel aber ständig unter Feuer, damit es, so die Theorie, im Notfall in Sicherheit gebracht werden konnte. Die Wirklichkeit hielt sich aber nicht an die Theorie. Die Discovery wurde vom Eis eingeschlossen und zu seinem Gefangenen.
Ungeachtet dessen beschrieb Wilson das Winterquartier der Discovery als den »idealen Naturhafen« – wohl auch, weil es hier zahllose Weddellrobben gab. Die stete Versorgung mit frischem Fleisch, so Wilsons Hoffnung, würde Skorbut vorbeugen, jener gefürchteten Krankheit, die durch den Mangel an Vitamin C entsteht und seit Hunderten von Jahren die Geißel aller Seefahrer war. Doch wie die Überlegungen zur Flucht vor dem Packeis erwies sich auch Wilsons Hoffnung, Skorbut vermeiden zu können, als reines Wunschdenken. Vielmehr müssen wir davon ausgehen, dass die Besatzung der Discovery schon bei dieser ersten Überwinterung Anzeichen von Skorbut zeigte, weil es nicht genügend frisches Rind- oder Schweinefleisch oder gar Gemüse zu essen gab. Zudem missfiel den Männern der extrem fischige Geschmack des Robbenfleisches, weshalb sie Dosenfleisch bevorzugten. Und so waren sie körperlich bereits geschwächt, ehe ihre eigentliche Arbeit auch nur begonnen hatte.
Als Erstes errichteten sie unweit des Schiffes eine zweite Hütte, um schließlich mit dem blutigen, aber notwendigen Geschäft des Schlachtens von Robben und Pinguinen zu beginnen. Der Geschmack des Fleisches mochte abstoßend sein, aber im Winter würden sie es brauchen. Nachdem sie sich halbwegs akklimatisiert und mit der Umgebung vertraut gemacht hatten, unternahmen sie auch kürzere Erkundungstouren. Auch der Umgang mit Skiern wurde geübt, trotz der Vorbehalte, die Scott dem Fortbewegungsmittel in diesem frühen Stadium der Expedition entgegenbrachte. Andere dachten anders darüber und hatten es unterdessen zu einigem Können gebracht, allen voran der Chefmaschinist Skelton, der, wie Scott notierte, sich von allen Offizieren am geschicktesten anstellte, um einschränkend hinzuzufügen: »Ein paar Männer liegen aber fast gleichauf.« Er selbst unternahm merkwürdigerweise aber nichts, um das Training auf Skiern zu fördern. Ein Grund für seine Zurückhaltung mag gewesen sein, dass er in einen Zwischenfall verwickelt war, bei dem er stürzte und sich eine Oberschenkelzerrung zuzog.
Merkwürdig mutet auch an, dass es keinerlei Training mit den Schlittenhunden gab, die die Reise gen Süden mitgemacht hatten, um vor Ort die Ausrüstung übers Eis zu ziehen, solange die Bedingungen es zuließen, und es den Männern zu ersparen, sich selbst vor die Schlitten spannen zu müssen. Wie bereits angedeutet, galten Schlittenhunde als die beste Art der Fortbewegung übers Eis, propagiert nicht zuletzt von Amundsen. Scott aber ließ sich von den veralteten Ansichten Markhams leiten und setzte auf die ungleich mühsamere und eintönigere Methode, bei der sich die Männer selbst ins Geschirr einspannen und den schwer beladenen Schlitten übers Eis ziehen – die wohl strapaziöseste Art der Fortbewegung, die sich auf Erden denken lässt. Einen 360 Kilogramm schweren Schlitten im Schneckentempo über unebenes, von Rissen und Spalten durchzogenes Eis zu manövrieren ist eine Herausforderung ganz eigener Art. Bei Temperaturen von bis zu –40 °C, Schneetreiben und starkem Wind wird es zu einer Tortur.
Das Zuggeschirr ist so konstruiert, dass der größte Druck auf der Hüfte lastet, doch wenn der Schlitten festsitzt, muss man ihn hin und her bewegen und sogar anheben, um ihn wieder flottzubekommen. Auf weichem Schnee ist die Anstrengung besonders groß, weil der Schlitten permanent einsinkt. Ihn dann vorwärtszubewegen gleicht dem Versuch, ein schweres Gewicht durch tiefen Sand zu ziehen. In jedem Fall war die Arbeit eine Plackerei, vor der alle Besatzungsmitglieder, ungeachtet ihres Dienstgrades, gleich waren. Offiziere und Mannschaft waren ins selbe Geschirr eingespannt und kämpften gemeinsam einen schweren Kampf, in dem jeder Einzelne sein Bestes gab.
Zum Ausgleich für die Strapazen war genügend nahrhaftes Essen unerlässlich, doch sobald die Männer das Lager verlassen hatten, gab es keine Robben, Pinguine oder Vögel mehr, die ihnen hätten Fleisch liefern können. Und so mussten sie jedes Gramm, das sie unterwegs essen wollten, auf den Schlitten mitschleppen.
Die derart bepackten Schlitten über eine größere Distanz zu bewegen war eine Herkulesaufgabe, die die Männer vor das Problem stellte, das Gewicht des Schlittens und die zu überwindende Distanz in das richtige Verhältnis zu bringen – ein nahezu unmögliches Unterfangen, von dessen Gelingen aber doch ihr Leben abhing. Je größer die Entfernung, desto mehr Vorräte mussten mit, und je mehr sie schleppen mussten, desto schwächer wurden sie und desto langsamer kamen sie voran. Die richtige Menge Vorräte für die vorgesehene Distanz zu bestimmen glich daher einem Balanceakt.
Zur Lösung des Problems war es üblich, dass Forschungsreisende in regelmäßigen Abständen Vorratsdepots anlegten, aus denen sie sich bei Bedarf bedienen konnten. Doch auch diese Methode änderte nichts daran, dass sie mit der Art der Fortbewegung nur so weit kamen, wie der Vorrat reichte, den sie auf die Schlitten packten. Und das waren im besten Fall 400 Kilogramm. Ein Schlitten wurde im Regelfall von vier Personen gezogen, von denen jede folglich bis zu hundert Kilogramm durch weichen Schnee schleppen musste, dabei gelegentlich bis zur Gürtellinie einsank und permanent eiskaltem Wind ausgesetzt war. Fast noch schwerer wog die Angst, das Eis unter dem Schnee könnte brechen, die Männer verschlucken und in eine eisige Hölle schicken, in der der Tod auf sie wartete.
Obwohl diese Gefahr jedem bekannt sein musste, wurde die Notwendigkeit, die Männer mit ausreichend Nahrung bei Kräften zu halten, immer wieder ignoriert. Über Kalorien und Vitamine wusste man damals noch sehr wenig, entsprechend unausgewogen war das Essen, das die Männer bekamen. Zudem nahmen sie notorisch zu wenig Flüssigkeit zu sich. Um etwas trinken zu können, musste zunächst Eis oder Schnee geschmolzen werden, doch der Brennstoff, der dafür nötig war, war rationiert und für die Zubereitung der Mahlzeiten reserviert. Das führte dazu, dass sich unterwegs niemand die Mühe machte, bei einer Pause erst das Zelt aufzubauen und den Primuskocher anzuwerfen, nur um eine Tasse Tee trinken zu können.
Die Männer im Zuggeschirr waren der grimmigen Kälte, Erfrierungen, Schneestürmen, extremen Winden, Schneeblindheit und den Gefahren durch Spalten im Eis ausgesetzt, doch das Schlimmste waren wohl der permanente Durst und Hunger.
Traditionell bildeten sich die Briten viel auf ihre Fähigkeit ein, selbst mit den widrigsten Bedingungen fertigzuwerden. Unter dem Einfluss Markhams war der Glaube an die eigenen Fähigkeiten noch gewachsen. Und so warfen sich die Männer mit der stillen Entschlossenheit ins Geschirr, die Leine, durch die sie mit dem Schlitten verbunden waren, auf Zug zu halten und mindestens so lange durchzuhalten wie der Nebenmann. Die Anstrengungen begriffen sie als Ritterschlag, und sie weigerten sich, moderne, weniger qualvolle Methoden der Fortbewegung im Eis mit Hunden oder Skiern zur Kenntnis zu nehmen.
Читать дальше