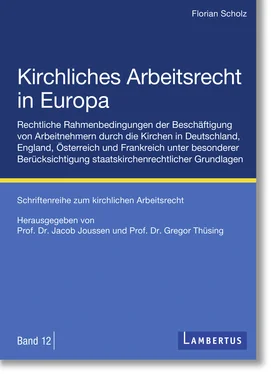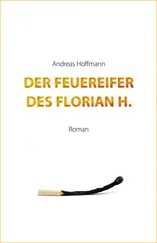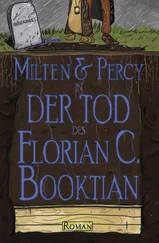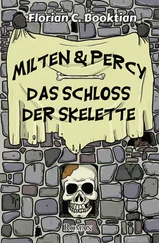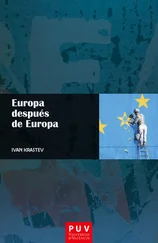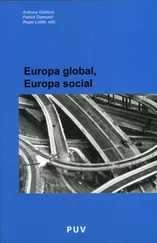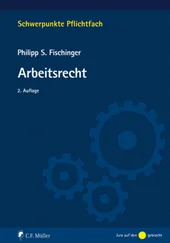Grundlegend gilt, dass sowohl der Begriff des Religionsverfassungsrechts als auch der Begriff des Staatskirchenrechts jeweils einen Teilaspekt des Verhältnisses von Staat und Religion erfasst. Die Begriffe schließen sich daher nicht aus, sondern ergänzen sich. 32Im Zusammenhang des kirchlichen Arbeitsrechts stehen aber die Kirchen als Institution im Mittelpunkt, weniger die individuellen Rechte ihrer einzelnen Mitglieder. Entscheidend ist, welche Freiheiten den Kirchen bei der Beschäftigung von Arbeitnehmern gewährt werden. Diese Fragestellung ist aus der institutionellen Perspektive zu beurteilen. Zudem ist die begriffliche Fokussierung auf die Kirchen im hier zu untersuchenden Kontext nicht nachteilig, da es ausschließlich auf deren Rechtsstellung ankommt. Dem Begriff Religionsverfassungsrecht mag diesbezüglich grundsätzlich eine „begrüßenswerte Klarstellungsfunktion“ 33zukommen, doch ist sie im Zusammenhang dieser Arbeit entbehrlich.
Ebenso steht die Durchführung eines europäischen Rechtsvergleichs einer Verwendung des Begriffs des Staatskirchenrechts nicht entgegen. 34Denn auch in den anderen für diese Darstellung maßgeblichen Rechtsordnungen ist eine entsprechende Terminologie zur Bezeichnung der rechtlichen Beziehungen zwischen Staat und den Kirchen durchaus geläufig. So wird dieses Rechtsgebiet in Frankreich als droit civil ecclésiastique 35und in England als ecclesiastical law 36bezeichnet. In Österreich wird ohnehin traditionell die Bezeichnung Staatskirchenrecht verwendet. 37Schließlich wird auf gesamteuropäischer Ebene eine juristische Erörterung des Staat-Kirche-Verhältnisses durch den seit 1989 bestehenden Zusammenschluss des European Consortium for Church and State Research geführt. 38
Weniger bedeutsam ist insofern, dass seit einigen Jahren auch innerhalb anderer Staaten eine entsprechend der in der deutschen Rechtslehre geführte Terminologiedebatte zu beobachten ist. Dabei wird sowohl in Österreich 39, Frankreich 40als auch in England 41zunehmend eine Akzentuierung der Religion im Allgemeinen zur Bezeichnung des Rechtsgebiets gefordert. Wie bereits dargelegt, sind diese Einwände für die hier vorzunehmende Untersuchung aber nachrangig; ohnehin stellen Rechtstermini im internationalen Kontext nur Orientierungspunkte dar, bei deren Verständnis nicht ausschließlich an der nationalen Perspektive zu haften ist.
b) Kirchen und Religionsgemeinschaften
Der Übersichtlichkeit und sprachlichen Vereinfachung halber werden in dieser Arbeit zumeist lediglich die Kirchen als Träger der vom jeweiligen nationalen Staatskirchenrecht vorgesehenen Gewährleistungen und Rechtspositionen erwähnt, auch wenn andere Religionsgemeinschaften ebenso vom Schutzbereich der entsprechenden Normen erfasst sein sollten. Ein Ausschluss dieser übrigen Religionsgemeinschaften ist damit nicht impliziert. Für diese Untersuchung ist jedoch ausschließlich die Rechtslage für die Kirchen maßgebend.
3. Territoriale Reichweite der Länderberichte
Schließlich ist auch eine Präzisierung bzw. Erläuterung der geographischen Terminologie vorzunehmen. Denn die territoriale Reichweite der Untersuchung der einzelnen Rechtsordnungen ist zur Begrenzung des Erörterungsumfangs notwendigerweise eingeschränkt.
Das aus den Ländern England, Wales, Schottland und Nordirland bestehende Vereinigte Königreich unterscheidet sich hinsichtlich seiner einzelnen staatskirchenrechtlichen Ordnungen ganz erheblich. 42Eine Betrachtung der Rechtslage im gesamten britischen Staat würde wegen dieser Divergenz den Umfang der vorliegenden Arbeit sprengen. Die Untersuchung ist daher bewusst auf England beschränkt.
Auch in Frankreich besteht in territorialer Hinsicht kein gänzlich einheitliches staatskirchenrechtliches System. Aus historischen Gründen besteht in den drei Départements Elsass-Lothringens ( Haut-Rhin , Bas-Rhin , Moselle ) eine andere Rechtslage als im Reststaat. 43Auch die rechtlichen Gegebenheiten in den überseeischen Départements und Territorien unterscheiden sich. 44Diese Besonderheiten müssen hier unberücksichtigt bleiben.
II. Methodik
1. Rechtsvergleichender Ansatz
Der Maxime des Nestors der Rechtsvergleichung Ernst Rabel folgend, „der Stoff des Nachdenkens über die Probleme des Rechts muss das Recht der gesamten Erde sein (…)“ 45, sollen in dieser Arbeit bei der Darstellung des kirchlichen Arbeitsrechts die staatlichen Grenzen überschritten werden. Ein wie von Rabel geforderter universalistisch-globaler Ansatz kann jedoch für den Einzelnen wegen unüberwindlicher zeitlicher wie auch sprachlicher Grenzen nur Utopie bleiben. Der durchgeführte Vergleich muss daher ausschnitthaft sein, er bleibt notwendigerweise oberflächlich und fragmentarisch. 46Gerade deshalb darf die Auswahl der zu vergleichenden Rechtsordnungen aber nicht beliebig geschehen, sondern sollte nachvollziehbaren Kriterien folgen. 47Dafür bietet sich ein exemplarischer Vergleich an, der aber eine geeignete Schematisierung verschiedener Rechtsordnungen im Hinblick auf die untersuchte Thematik erfordert.
Da das kirchliche Arbeitsrecht als Modifikation und Abweichung vom weltlichen Arbeitsrecht ganz wesentlich von der den Kirchen gewährten Autonomie abhängig ist, bildet das Staatskirchenrecht das Fundament für dessen Ausgestaltung. Die grundlegende Einteilung des Staat-Kirche-Verhältnisses in drei Staatskirchensysteme 48bietet insoweit eine geeignete Orientierung, durch Heranziehung idealtypischer Repräsentanten der drei verschiedenen staatskirchenrechtlichen Grundsysteme den Erkenntniswert der Untersuchung zu maximieren. Dabei repräsentiert in dieser Untersuchung England das Modell einer Staatskirche, Frankreich das laizistisch geprägte Trennungssystem und Österreich 49(entsprechend der deutschen Rechtslage) das Kooperationsmodell. Insoweit bilden das französische und englische Modell nach dieser Einteilung die „äußeren Pole“ 50des europäischen staatskirchenrechtlichen Panoramas. Auch die Tatsache, dass die grundlegenden staatskirchenrechtlichen Entscheidungen von Frankreich und England als prototypische Wegbereiter erheblichen Einfluss auf andere europäische Länder hatten, 51erhöht den Vergleichswert dieser Rechtsordnungen. Überdies kommt England als Vertreter des Rechtskreises des Common Law eine besondere Stellung gegenüber den übrigen kontinentaleuropäischen Rechtsordnungen zu.
Die staatskirchenrechtliche Fundierung des kirchlichen Arbeitsrechts hat zur Folge, dass die Durchführung einer reinen sogenannten „Mikrovergleichung“ 52– dies wäre vorliegend ausschließlich eine Untersuchung der arbeitsrechtlichen Fragestellungen – in einer derart isolierten Form nicht aussagekräftig wäre. Zwar verfolgt diese Arbeit primär das Ziel, die rechtliche Stellung der Kirchen als Arbeitgeber zu beleuchten. Dies kann indes nicht ohne die Durchführung einer sogenannten „Makrovergleichung“ 53geschehen, in deren Verlauf auch die im Kontext der eigentlichen Fragestellung stehenden Grundsätze der jeweiligen Rechtsordnungen untersucht werden. Denn ohne die staatskirchenrechtlichen, historischen und kulturellen Hintergründe ließen sich Inhalt, Auslegung und Rechtsfolgen der einzelnen Normen und Regelungen des kirchlichen Arbeitsrechts nicht oder nur unzureichend erschließen. Zudem gewinnt die Analyse einer ausländischen Rechtsordnung insbesondere dann an Erkenntniswert, wenn auch ein Verständnis für die den einzelnen Regelungen zugrunde liegenden Ursachen und Grundbedingungen gewonnen werden kann. Erst auf dieser Basis ist eine aussagekräftige Kontrastierung mit der deutschen Rechtslage durchzuführen, durch die das Verständnis der eigenen rechtlichen Zusammenhänge geschärft werden kann. Daraus folgt der Grundsatz der Rechtsvergleichung, dass auch beim „Mikrovergleich“ einzelne Vorschriften zumeist nur im Gesamtzusammenhang der jeweiligen Rechtsordnung untersucht werden können. 54
Читать дальше