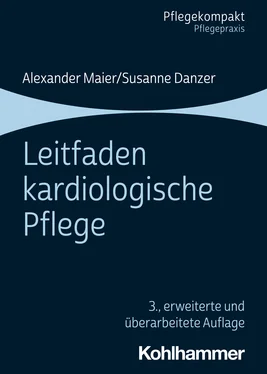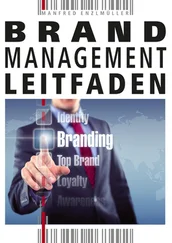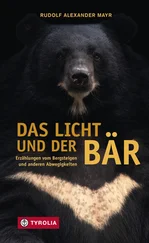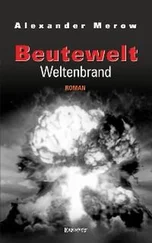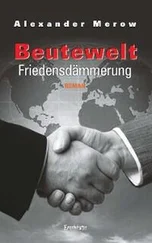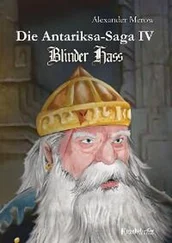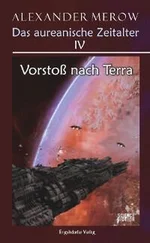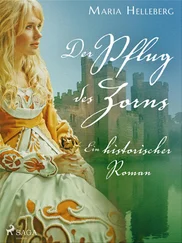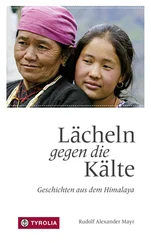• Als Positionierung zum Essen ist es möglich, den Patienten mit gestrecktem Bein auf die Punktionsseite zu drehen und das Bett am Fußteil leicht schräg zu stellen.
• Hilfe bei der Ausscheidung einschließlich der Kontrolle, ob der Patient Spontanurin gelassen hat. (Da manche Patienten im Liegen kein Wasser lassen können, kann nach Absprache mit dem Patienten vor der Intervention ein Blasenkatheter gelegt werden, der nach Aufhebung der Bettruhe wieder entfernt wird.)
• Erstes Aufstehen nach Aufhebung der Bettruhe in Begleitung einer Pflegekraft, da es nach langem strengem Liegen zu Kreislaufdysregulationen mit Kollaps des Patienten kommen kann → Blutdruckabfall, Blässe, Kaltschweißigkeit, Übelkeit, ggf. Erbrechen.
2.4.9 Entfernen eines Druckverbands
• Bei einem mit Pflasterstreifen geklebten Druckverband (z. B. mit Leukoplast ®hospital) kann ein Pflasterlöser verwendet werden, zum Beispiel Leukotape remover ®. Dieser wird großzügig auf das Pflaster aufgebracht und danach sollte ca. 1 Minute gewartet werden, damit das Mittel das Pflaster lösen kann. Schließlich wird der Verband vorsichtig entfernt. Die Haut sollte anschließend mit einem feuchten Einmalwaschlappen abgewaschen werden, um den Löser zu entfernen.



Durch den hohen Alkoholgehalt des Pflasterlösers kann es zu einem Brennen auf der Haut kommen, das sich aber schnell verflüchtigt.
• Bei einem Klettverband wird der Verband einfach geöffnet und entfernt. Bei einem zirkulären Verband mit Druckpolster wird dieser einfach aufgeschnitten.
• Die Einstichstelle sollte desinfiziert und mit einem kleinen Vliespflaster (z. B. Cutiplast ®steril) oder Folienpflaster (z. B. OpSite ®postop) mit Wundpolster verschlossen und täglich kontrolliert werden.
• Zudem sollte die Leiste auf Hämatombildung und Verhärtungen untersucht werden.
• Die Leiste sollte beidseitig mit einem Stethoskop auf (pulsierende) Strömungsgeräusche kontrolliert werden (je nach Klinik ärztliche Tätigkeit, kann jedoch auch nochmal durch Pflegepersonal erfolgen).
• Hautirritationen können durch eine gute Hautpflege behandelt werden, sodass sich die Haut schnell wieder beruhigt.
• Bei Spannungsblasen sollten diese mit einem Pflaster bedeckt werden, um sie vor Reibung zu schützen. Blasen nicht eröffnen! → Infektionsrisiko
• Bei Hautläsionen durch Pflasterdruckverbände können diese mit unterschiedlichen Verbandstoffen versorgt werden. Die Umgebung des Defekts sollte zuvor von Pflasterresten gereinigt werden.
Die Wunde kann entweder mit einer Wundgaze bedeckt und mit Kompressen und einem Klebevlies abgedeckt werden. Ebenso lassen sich transparente Hydrokolloide verwenden (z. B. Comfeel ®plus transparenter Wundverband) oder ein Polyacrylatverband (z. B. Tegaderm ®absorbent). Durch das Abdecken des Hautdefekts kommt es zu einer raschen Schmerzlinderung, da diese oberflächlichen Defekte häufig Schmerzen verursachen.
Die Auswahl des Verbandstoffs hängt auch davon ab, wie stark die Wunde nässt. Vorteil bei transparenten Hydrokolloiden und dem Polyacrylatverband sind die längere Verweildauer.
2.5 Echokardiale Untersuchungen
Die Echokardiographischen Untersuchungen lassen sich in ein Transthorakales Echo, ein Transösophagales Echo und in ein Stressecho unterscheiden.
2.5.1 Echo (TTE = Transthorakale Echokardiographie)
Mit Hilfe von Ultraschallverfahren werden Bilder des Herzens erstellt. Unter Zuhilfenahme des Dopplereffekts werden Blutflüsse und Fließgeschwindigkeiten gemessen.
Die Echokardiographie erteilt unter anderem Aussagen über Leistungsfähigkeit des Myokards einschließlich Wandbewegungsstörungen (wie Dyskinesie, Hypokinesie, Akinesie), Schließfähigkeit der Klappen, Vorhandensein von Tumoren, Thromben, Perikarderguss usw.
2.5.2 Transösophagales Echo (TEE)
Hierbei wird ein an einem Echoskop (einem Gastroskop ähnliches Gerät) sitzender Schallkopf über den Ösophagus direkt hinter dem Herzen platziert. Dadurch können die Vorhöfe, die Aorten- und Mitralklappe besser beurteilt werden.
Kleine Thromben und eine Endokarditis können durch diese Methode mit genauerer Aussagekraft beurteilt werden als bei einem normalen Echo.
2.5.3 Belastungs-Echokardiographie (Stress-Echo)
Das Stress-Echo wird unter körperlicher (z. B. Fahrradfahren) oder medikamentöser (z. B. Dobutamin, Dipyridamol) Belastung durchgeführt.
Diese Methode hilft, Ischämien des Herzens (lokale oder globale Kontraktionsstörungen des Myokards) zu erkennen, zu lokalisieren und deren Schwere einzuschätzen.
2.5.4 Pflegerische Nachsorge nach TEE
Da die meisten Patienten zur Erleichterung der Untersuchung z. B. Dormicum ®i. v. gespritzt bekommen, sollten sie nach Abschluss der Untersuchung überwacht werden. Wichtig ist dabei, die Sauerstoffsättigung, Atmung, Puls und Blutdruck in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren, bis der Patient vollständig wach ist.
Patienten sollten direkt nach einem TEE nicht trinken, da in der Regel der Rachen mit einem anästhesierenden Spray behandelt wird, so dass der Patient nicht merkt, wenn ihm Flüssigkeit in den Rachen läuft, was zum Verschlucken führen kann.
2.6 Röntgen, MRT
2.6.1 Röntgen
Beim Röntgen wird eine Aufnahme des Thorax in zwei Ebenen und in tiefer Inspiration gemacht. Dadurch lassen sich Aussagen über Form und Größe des Herzens treffen sowie über Stauungszeichen wie Lungenödem oder Pleuraergüsse.
Das Herz-CT ist eine schnelle und nicht-invasive Methode um eine gute Aussage über eine evtl. koronare Herzerkrankung zu erhalten. Sie wird eher bei Patienten angewandt, bei denen akut noch kein Herzkatheter indiziert ist und die Möglichkeit besteht, dass die Coronarien in einem guten Zustand sind (Ausschlussdiagnostik)
2.6.3 MRT (Magnetresonanztomographie, Kernspintomographie)
Durch ein starkes, statisches Magnetfeld werden die Atomkerne des Körpers in eine Richtung ausgerichtet. Bei ihrer Rückkehr in ihre Ausgangsposition entsteht eine elektrische Spannung, die als Signal erfasst, mittels Computer berechnet und zu optischen Bildern aufgebaut werden.
Vorteil des MRT ist, dass der Gewebekontrast deutlich höher ist im Vergleich zu Verfahren, die Röntgenstrahlen benutzen. Dadurch lässt sich krankes Gewebe besser von gesundem Gewebe unterscheiden.



Patienten mit Schrittmachern und metallischen Implantaten dürfen kein MRT erhalten, wenn diese nicht ausgewiesen MRT-tauglich sind.
2.7 Szintigraphie, PET
2.7.1 Myokardszintigraphie
Sie dient zur Abklärung von Myokardischämien. Die Untersuchung findet zumeist in Ruhe und in Belastung statt.
Dem Patienten wird eine radioaktiv markierte Trägersubstanz injiziert, die sich im Myokard anreichert.
Читать дальше