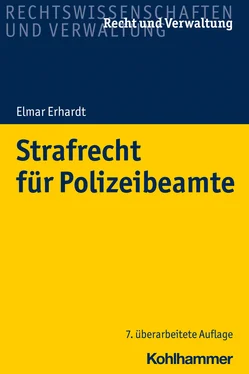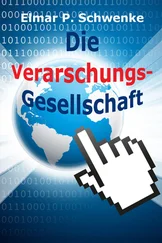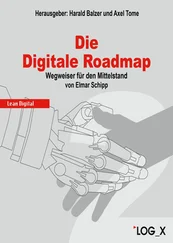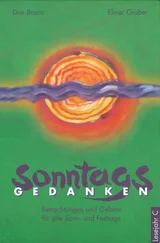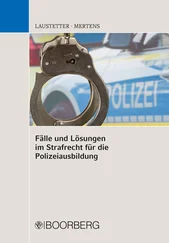1 ...6 7 8 10 11 12 ...22 Zu den allgemeinenVoraussetzungen eines jeden strafbaren Verhaltens gehören die Tatbestandsmäßigkeit, die Rechtswidrigkeitund die Schuld. Das sind die drei Wertungsstufen, die bei jeder Straftat geprüft werden müssen. Je nach Besonderheit des konkreten Falles müssen ggf. noch zusätzliche besondereVoraussetzungen der Strafbarkeit überprüft werden: Persönliche Strafausschließungs- oder Strafaufhebungsgründe sowie bestimmte Strafverfolgungsvoraussetzungen bzw. Strafverfolgungshindernisse.
1.Unterscheidung von Tatbestand und Rechtsfolge
19Die einzelnen Delikte im BT des StGB werden üblicherweise als Straftatbestände bezeichnet. So meint man beispielsweise mit dem Tatbestand des Diebstahls den § 242 in seiner Gesamtheit. Davon zu unterscheiden ist der Tatbestand im engeren Sinne, der die einzelnen typischen Merkmale enthält, die den Unrechtsgehalt des jeweiligen Delikts charakterisieren ( „Wegnahme einer fremden beweglichen Sache in rechtswidriger Zueignungsabsicht“ beim Diebstahl). Nicht zum Tatbestand in diesem engeren Sinne gehört die eigentliche Rechtsfolge( „wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft“ § 242 I). Jeder Straftatbestand ist nach dieser Struktur aufgebaut: Wer X tut, wird mit Y bestraft. So lautet § 223 I: „Wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“ Ein weiteres Beispiel ist die Freiheitsberaubung (§ 239 I): „Wer einen Menschen einsperrt oder auf andere Weise der Freiheit beraubt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“ Was jeweils vor dem Komma steht, ist der eigentliche Tatbestand, was nach dem Komma steht, ist die Rechtsfolge. Leider folgt das StGB nicht durchgängig diesem Strukturprinzip, wie auch sonst gelegentlich Systemungenauigkeiten oder doch zumindest mangelnde Sprachdisziplin zu beobachten sind. Ein Beispiel dafür ist die Beleidigung (§ 185). Die Vorschrift lautet: „Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe […] bestraft.“ Natürlich kann „die Beleidigung“ selbst nicht bestraft werden, sie wird weder eine Geldstrafe bezahlen noch eine Freiheitsstrafe absitzen. Man müsste also diesen Straftatbestand nach dem oben genannten Prinzip zumindest in Gedanken umformulieren: „Wer eine andere Person beleidigt, wird […] bestraft.“ Nicht die Beleidigung, sondern die Person, die beleidigt hat, soll und kann bestraft werden. Hinzu kommt, dass § 185 keine Anhaltspunkte enthält, was unter einer Beleidigung zu verstehen ist. Wie so oft wird die Definition der Auslegung durch Rspr. und Rechtswissenschaft überlassen.
2.Die Tatbestandsmäßigkeit
20Die erste und zunächst wichtigste Voraussetzung der Strafbarkeit eines Menschen ist die Feststellung, ob der Tatbestand (im engeren Sinne) eines Delikts durch sein Verhalten erfüllt worden ist, im Folgenden Tatbestandsmäßigkeitgenannt. Diese folgt unmittelbar aus dem Gesetzlichkeitsprinzip, welches besagt, dass ein menschliches Verhalten nur dann bestraft werden kann, wenn das verbotene Tun in einem Gesetz vor der Tat deutlich beschrieben wurde. Den speziellen Vorgang zur Überprüfung, ob im konkreten Fall der Tatbestand verwirklicht wurde, haben wir oben als Subsumtionbezeichnet. Der gesetzliche Tatbestand enthält zunächst objektiveMerkmale. Das können deskriptive (beschreibende) oder normative (wertende) Merkmale sein. Der objektive Tatbestandbeschreibt Merkmale, die das äußere (objektive) Erscheinungsbild der Tat bestimmen. Sie stellen die sinnlich wahrnehmbaren Vorgänge in der Außenwelt, in Abgrenzung der subjektiven Innenwelt (Vorstellung) des Täters dar. Im objektiven Tatbestand stehen Beschreibungen des Tatsubjekts (z. B. „wer“ = jedermann; Amtsträger, Arzt, Richter usw.), des Tatobjekts (z. B. Mensch, Sache, Kraftfahrzeug, Urkunde, Wohnung usw.) und der Tathandlung (z. B. töten, wegnehmen, täuschen, nötigen, herstellen, verfälschen usw.). Der subjektive Tatbestandbeinhaltet dagegen innere Umstände, die dem psychisch-seelischen Bereich und der Vorstellungswelt des Täters angehören (Vorsatz, Absichten, Beweggründe, Motive). Nach heutiger Lehre können Tatbestände auch subjektiveMerkmale enthalten wie bestimmte Motive (z. B. die Habgier beim Mord) oder Absichten (z. B. die Zueignungsabsicht beim Diebstahl). Nach der in diesem Lehrbuch vertretenen Ansicht gehört auch der Vorsatz als subjektives Merkmal bereits zur Tatbestandsmäßigkeit.
21Ein tatbestandsmäßiges Verhalten muss nicht automatisch strafbar sein, es kann vielmehr ausnahmsweise erlaubt sein. Das Recht kennt zahlreiche Erlaubnisnormen, die man auch Rechtfertigungsgründenennt. Die bekanntesten sind Notwehr(§ 32), Rechtfertigender Notstand(§ 34) oder auch die vorläufige Festnahme(§ 127 StPO). Hat man im konkreten Fall die Tatbestandsmäßigkeit bejaht, verschafft dies im Normalfall ein Indiz dafür, dass die Tat auch rechtswidrig ist. Sicher ist die Feststellung der Rechtswidrigkeit aber erst, wenn man das Vorliegen eines ausnahmsweise eingreifenden Rechtfertigungsgrundes verneinen kann. Das Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes ist eine Ausnahme von der Indizwirkung der Tatbestandsmäßigkeit. Rechtfertigungsgründe sind deshalb nur zu prüfen, wenn der Sachverhalt dazu besondere Anhaltspunkte liefert (z. B. eine Angriffs- oder Gefahrensituation). In Abgrenzung zum Straftatbestand nennt man die Rechtfertigungsgründe auch Erlaubnistatbestände(oder Erlaubnisnormen), da sie eigentlich verbotenes Verhalten (weil tatbestandsmäßig) ausnahmsweise erlauben bzw. rechtfertigen. Aus diesem logischen Verhältnis resultiert der Merksatz: „Die Tatbestandsmäßigkeit indiziert die Rechtswidrigkeit .“
22Auch eine tatbestandsmäßige und rechtswidrige Tat ist noch nicht ohne weiteres strafbar. Darüber hinaus wird erst auf einer dritten Wertungsstufe, der Schuld, entschieden. Im deutschen Strafrecht gilt das in Art. 1 GG als Ausprägung der Menschenwürde verankerte Schuldprinzip: Bestraft werden kann nur jemand, der schuldhaftgehandelt hat. Auch auf dieser Deliktsstufe gilt eine Indizwirkung: Liegen die Deliktsstufen Tatbestandsmäßigkeit und Rechtswidrigkeit vor, wird die Schuld indiziert, d. h. wer tatbestandsmäßig und rechtswidrig eine Straftat begangen hat, handelt im Normalfall auch schuldhaft. Während es bei der Rechtswidrigkeit um den Widerspruch zur Rechtsordnunggeht, beinhaltet die Frage der Schuld die persönlicheVorwerfbarkeit. Schuld ist etwas Individuelles, etwas höchst Persönliches. Der Bundesgerichtshof hat schon sehr früh eine bis heute gültige Definition der Schuldgefunden: „ Schuld ist Vorwerfbarkeit. Mit dem Unwerturteil der Schuld wird dem Täter vorgeworfen, dass er sich nicht rechtmäßig verhalten hat, dass er sich für das Unrecht entschieden hat, obwohl er sich rechtmäßig verhalten, sich für das Recht hätte entscheiden können.“ 22
Das Unrechtsurteil besagt nur, dass die Tat im Widerspruch zur Rechtsordnung steht, oder mit anderen Worten, dass sie rechtlich missbilligt wird. Die Frage der persönlichen Verantwortlichkeit des Täters ist damit noch nicht beantwortet. Bei der Schuld geht es darum, ob dem Täter die Tat ganz individuell und persönlich vorgeworfen werden kann, was nicht der Fall ist, wenn der Täter nicht persönlich verantwortlich ist, weil er beispielsweise seelisch so gestört ist, dass er das Unrecht der Tat nicht einsehen kann (§ 20). Diese Schuldunfähigkeitist aber nicht der einzige Schuldausschließungsgrund. Die Schuld kann auch ausgeschlossen sein, wenn der Täter sich in einem unvermeidbaren Verbotsirrtum(§ 17) befand, oder wenn zu seinen Gunsten ein Entschuldigungsgrund(z. B. entschuldigender Notstand nach § 35) eingreift.
Читать дальше