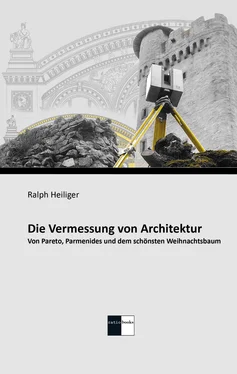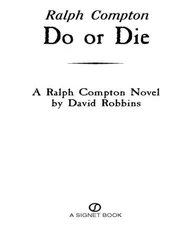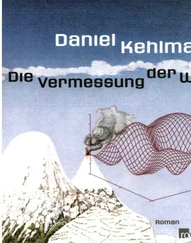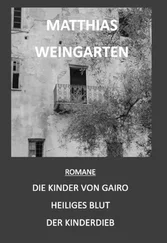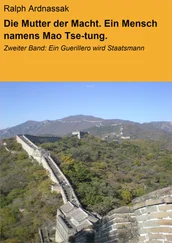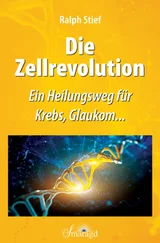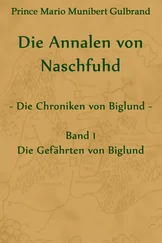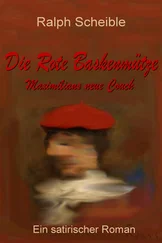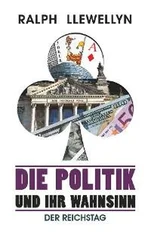1. für die Planung, indem die Bestandsaufnahme den aktuellen Zustand dokumentiert und belastbare Planungsgrundlagen schafft,
2. für die Kunstgeschichte, indem die Bestandspläne für die Erforschung der Denkmäler dienen und
3. für die Denkmalpflege, weil die Dokumentation die notwendige Orientierung bietet, das Denkmal zu erhalten.
Mit Zunahme der Baumaßnahmen im historischen, denkmalgeschützten Bestand stieg auch der Bedarf an Bestandsaufnahmen. 1984 brachte der Architekt und Bauarchäologe Johannes Cramer das Buch „Handbuch der Bauaufnahme“ heraus. Es bietet eine Arbeitshilfe für die in der Bauaufnahme tätigen Fachkräfte. Er gliedert die Bauaufnahme in5:
- das Bauaufmaß,
- die Baubeschreibung,
- die Fotografie,
- die Bauuntersuchung und
- die Zeichnung.
Zwei Jahre später erläuterte Gerda Wangerin in ihrem Buch „Bauaufnahme – Grundlagen, Methoden, Darstellung“, dass zur Bauaufnahme gehören6:
- das Aufmaß vor Ort und
- die zeichnerische Wiedergabe,
- die schriftliche Wiedergabe und
- die Baugeschichte.
Ähnlich formulierten 1993 der Denkmalpfleger Michael Petzet und der Bauforscher Gert Mader in dem als Standardwerk geltenden Buch „Praktische Denkmalpflege“ den Begriff Bauaufnahme. Sie zählen hierzu:
- Bestandspläne einschließlich Beschreibung,
- Befundbeobachtung und
- Befunduntersuchung,
- die fotografische Erfassung,
- das Raumbuch und
- archivalische Nachforschungen.
Allerdings reduzierten sie den Begriff Bauaufnahme später in Anlehnung an Wangerin auf die Vermessung und die maßstäbliche Aufzeichnung, also auf das, was Cramer mit Bauaufmaß bezeichnet.7 Die Begriffe Bauaufmaß und Bauaufnahme werden in der Literatur synonym verwandt. So auch bei dem Kunsthistoriker Ulrich Großmann, der in seinem Buch „Einführung in die historische und kunsthistorische Bauforschung“ hinter dem Begriff Bauaufnahme in Klammern das Aufmaß setzt.8 Jürgen Giese, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bamberg, fasst unter Bauaufnahme zusammen9:
- die Zeichnung,
- die Beschreibung und
- die Fotodokumentation.
Die gebaute Wirklichkeit wird gezeichnet, beschrieben und fotografiert. Diese Dreiheit nennt er Basisverfahren einer Baudokumentation. Zu den Zusatzverfahren zählen archäologische Untersuchungen, Dendrochronologie (Altersbestimmung), Materialprüfungen und -analysen, restauratorische Befunduntersuchungen, Baugrunduntersuchungen und viele andere mehr. Die Zweiteilung in Basisverfahren und Zusatzverfahren leuchtet ein; die Basisverfahren schaffen ein maßlich stimmiges Abbild: Die Zeichnung dokumentiert die Bauwerksgeometrie, die Beschreibung ergänzt, was nicht oder nur schwer verständlich gezeichnet werden kann, und Fotos geben einen visuellen Eindruck. Die Zusatzverfahren bieten Detailkenntnis: Zum Beispiel hilft uns die Dendrochronologie bei der Bestimmung des Baujahres. Materialanalysen lassen auf statische Eigenschaften schließen. Archäologische Untersuchungen vermögen das Bauwerk in seiner Geschichte einzubinden. Die Ergebnisse der Zusatzverfahren erweitern das Basiswissen.
In diesem Buch wird dem Begriff Bauaufmaß der Vorzug gegenüber der Bauaufnahme gegeben, weil hier das Messen ablesbar ist, während die Bauaufnahme wie die Bestandsaufnahme mehr Allgemeinbegriffe sind. Das Bauaufmaß führt zum Baubestandsplan. Und dieser muss vor allem eines: Er muss stimmen. Er muss das reale Bauwerk maßlich und geometrisch exakt wiedergeben.10 Vor allem gehören hierzu die durch Alterung und Lastenumverteilung bewirkten Verformungen.11 Das Aufmaß soll so genau sein, dass Verformungen zweifelsfrei aufgedeckt werden. Ihre lagerichtige Darstellung ermöglicht, die Schadenssituation und statischen Verhältnisse der Baukonstruktion zu beurteilen. Auf dieser Grundlage können Instandsetzungen geplant werden und kontrolliert ablaufen.12
In den 1980er Jahren hat sich für diese Dokumentationsqualität der Terminus verformungstreu herausgebildet. Das verformungstreue Bauaufmaß etabliert sich rasch als Kennzeichen der Historischen Bauforschung. Diese Qualität war in der Tat neu. Verformungen aufdecken galt bis dahin als große Herausforderung. Mit dem gewöhnlichen Architektenaufmaß war das schlicht unmöglich; denn beim Architektenaufmaß wird das Bauwerk in wenigen Einzelmaßen und mit einem geübten Blick für Proportionen visuell erfasst. Das Ergebnis ist ein mehr oder weniger idealisierter Grundriss, in der Darstellung zwar treu der Raumabfolge, aber bei weitem nicht treu in seiner maßlich-geometrischen Aussage. Deformationen bleiben bei dieser Methode außen vor.
Dagegen nutzte das verformungstreue Handaufmaß Schnüre als physisch greifbare Hilfslinien. Von einer Basislinie beginnend suchte man Dreiecke zu spannen und aneinanderzulegen. Das System aus Messtechnik, Verfahren, Mensch und Bauwerk musste schon sehr gut aufeinander abgestimmt sein. Schlich sich an irgendeiner Stelle eine Ungenauigkeit ein, zum Beispiel durch ein nicht horizontal gestrafftes Messband, pflanzte sich der Fehler unaufhaltsam im Dreiecksnetz fort. Wenn auch Verformungen so nicht immer zweifelsfrei aufdeckbar waren, mitunter durch Maßfehler auch scheinbare Formabweichungen entstanden, so bot das Verfahren zumindest den Vorzug, dass die Maßzuverlässigkeit gegenüber dem Architektenaufmaß erheblich gesteigert war.
Die Fehleranfälligkeit des Dreiecksnetzes sank schlagartig, als die Bauforscher in den 1980ern beginnen, den aus dem Vermessungswesen bekannten Winkelmesser – den Theodoliten – einzusetzen. Auf einmal waren neben den Seiten des Dreiecks auch die Winkel messbar. Es gab plötzlich überschüssige Messwerte, die das Messnetz stabilisierten und in sich kontrollierten. Auch das Messen außerhalb der Horizontalen war nun einfacher. Mit dem Theodoliten lassen sich Punkte anzielen, die weit oberhalb oder unterhalb der Rissebene liegen – ein nicht zu unterschätzender Aspekt bei Bauwerken, die sich ja bekanntlich in der Vertikalen oft über mehrere Geschosse erstrecken. Bauforscher können auf einmal wesentlich einfacher als mit Loten klären, inwieweit die Grundrissgeometrie des oberen Geschosses mit der des Erdgeschosses übereinstimmt. Werden die gemessenen Punkte in die Zeichnung übertragen und mit Linien verbunden, zeigen sich auf einmal keine geraden, sondern gekrümmte Konturen: Verformungen treten zutage. Der Einsatz vermessungstechnischer Instrumente und Verfahren galt Anfang der 1990er Jahre als etabliert. Sie gewährleisten maßliche Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verfahrens.13
Das verformungstreue Aufmaß hatte zu einer enormen Genauigkeitssteigerung in der Bauforschung geführt. Die moderne Messtechnik ließ die Geometrie eines Bauwerks zuverlässig bestimmen. Schiefwinkligkeiten, Krümmungen und Wölbungen konnten sicher erfasst werden. Abweichungen von idealen Formen wurden nachweisbar. Das war wohl spektakulär! Im Rückblick wird verständlich, dass der Fortschritt im Bauaufmaß für jeden Bauforscher gewaltig erscheinen musste. Und dieser Eindruck manifestierte sich im Ausdruck „verformungstreu“. Streng genommen war es aber nur die Übernahme längst erprobter Werkzeuge und Verfahren des Vermessungswesens. Diese waren keineswegs spektakulär, auch nicht neu. Sie waren einfach Stand der Technik zu jener Zeit, wenigstens im Vermessungswesen. Die Übernahme der Vermessungstechnik in die Bauforschung machte das Aufmaß der Bauforschung zu dem, was es immer schon sein wollte: exakt, präzise, genau. Verformungstreues Aufmaß bedeutet insofern den Einsatz moderner Vermessungstechnik.
Wer exakt dokumentieren möchte, der muss vermessen können. Allerdings ist das nur die halbe Wahrheit. Die Qualität einer Dokumentation hängt zugleich vom Kontakt zum Bauwerk ab: Messen und Zeichnen finden immer vor Ort in einem gemeinsamen Arbeitsgang statt.14 Gerade der Kontakt zum Bauwerk mit allen Sinnen lässt den Planer das Gebäude in all seinen Aspekten begreifen.15 Immer wieder nennt die Historische Bauforschung diese Einheit von Messen und Zeichnen. Was hat es damit auf sich?
Читать дальше