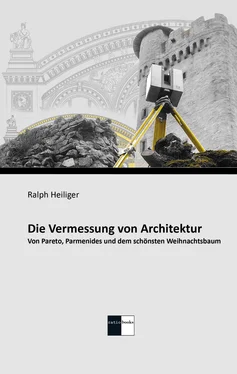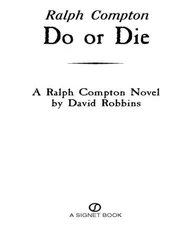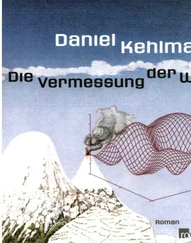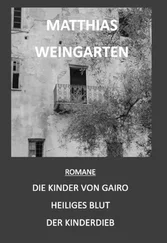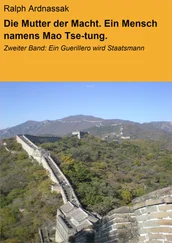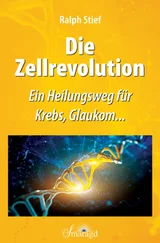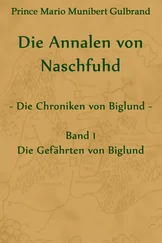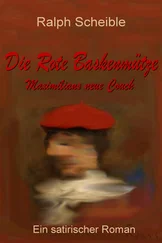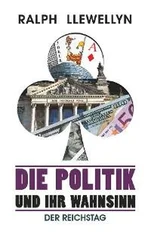Mein Ziel ist erreicht, wenn unser sorgloser, oft unbedachter Umgang mit Bestandsdaten ein wenig infrage gestellt wird, wenn sich ein Gefühl dafür entwickelt, welch positive Wirkung mit Bestandsdaten einhergeht, die sich auf die reale Welt beziehen, und welch großartige Chance in der Informationsnutzung steckt. Mut gehört dazu, dies zu wollen.
Mutig waren vor allem zwei Auftraggeber: das Bistum Münster und GALERIA Kaufhof. Ihnen verdanke ich vieles!
Bonn, im März 2016
Ralph Heiliger
1 Warum werden Gebäude vermessen?
Von den Grundlagen für das Planen im Bestand
1.01 Bauaufmaß zwischen Tradition und Moderne
„Darf ich Sie mal fragen, was Sie hier machen?“
„Wir vermessen das Gebäude.“
„Aha. Und wofür braucht man das?“
„Das Haus soll umgebaut werden, und für die Planung braucht der Architekt Bestandspläne.“
„Aber es hat sich doch nichts verändert! Das Haus steht doch immer noch so, wie es gebaut wurde.“
Im Witz gelingt es uns regelmäßig, den gegenteiligen Standpunkt einzunehmen und uns dabei köstlich zu amüsieren: „Ich bin außen“, ruft der Mathematiker, dem die Aufgabe gestellt ist, eine möglichst große Fläche mit einem Draht gegebener Länge abzustecken, und er – statt diese Fläche, wie jeder normal denkende Mensch es tun würde, im Kreis oder als Vieleck im Gelände zu markieren – sich selbst im Draht einwickelt und seine Position schlicht als „außen“ deklariert. Unerwartet und voller Scharfsinn trifft uns diese Antwort. Doch im gewöhnlichen Alltag fällt es uns schwer, einen Sachverhalt einfach mal umzudrehen: Warum wird dieses Haus vermessen?
Es fehlt das Quäntchen Heureka: Nicht das Gebäude ist der Grund für die Vermessung; es ist der einstige Plan des Gebäudes. Der hat sich vielleicht auch nicht verändert. Aber es wurde oft nicht so gebaut wie geplant, weil vielleicht andere Verhältnisse beim Bau vorgefunden wurden als bei der Planung angenommen. Zum Beispiel die Grundstücksbreite der Baulücke, die nun doch kleiner ist als im Kataster angegeben, oder der archäologische Fund, der rasch eine Änderung des Kellers erforderlich machte. Allzu oft werden solche Spontanänderungen im Plan nicht nachgeführt. Die Planung passt dann nicht mehr mit dem tatsächlich Gebauten überein. Und sobald das Haus steht, interessiert sich ohnehin niemand mehr dafür.
Nicht vergessen, sondern archiviert bleiben die Pläne in den Bauaktenarchiven der Städte, Kreise und Gemeinden. Sie gibt es seit dem 19. Jahrhundert.1 Mit jedem Bauantrag werden Pläne, Baubeschreibung, Statik und Lageplan der zuständigen Baubehörde zur Genehmigung eingereicht. Als Nachweis des Genehmigungsbescheides verbleiben sie im Bauaktenarchiv. Sie dokumentieren die beabsichtigte Planung, also das Bauvorhaben vor Baubeginn. Ein Nachführen der Pläne auf den Stand nach dem Bau ist nicht vorgesehen, ist aber auch nicht Aufgabe der Baubehörde. Und so sind amtlich archivierte Pläne für anstehende Sanierungen oder Umbauten mit Vorsicht zu gebrauchen. Nur in seltenen Fällen repräsentieren sie das tatsächlich Gebaute.
Da kann der Bauherr schon besser vorsorgen. Sein Auftrag an den Architekten umfasst in der Regel mehrere Leistungsphasen: Sie reichen von den ersten Gesprächen, in denen gemeinsam die Vorstellungen und das Machbare diskutiert werden, über die Phase des Entwerfens und Planens bis hin zur Ausführung des Bauvorhabens. Die letzte Phase ist der Dokumentation gewidmet. Hier erhält der Bauherr vom Architekten den letztgültigen Stand der Planung. Damit wäre es doch eigentlich getan, und der Bauherr könnte bei Umbauten auf diese Pläne zurückgreifen. – Ganz so ist es leider nicht. Denn die Dokumentation bezieht sich auf den letztgültigen Stand der Planung, nicht auf das tatsächlich Gebaute. Dieser feine Unterschied kann im Falle eines Umbaus zu heftigen Missverständnissen führen.
Manche Archivpläne erwecken zudem den Eindruck, als zeigten sie ein ganz anderes Gebäude als den Altbau, um den es geht. Dann nämlich, wenn Umbauten, Erweiterungen und Teilabrisse das Gebäude so in seiner Struktur verändert haben, dass man den Ursprungsbau kaum noch herauslesen kann. Wind und Wetter tun ihr Übriges, der Konstruktion beispielsweise historischer Fachwerkbauten zuzusetzen. Balken und Decken können sich unter der Last wechselnder Nutzungen verformt haben. Selbstverständlich zeigen Pläne, so denn überhaupt noch welche vorliegen, diese schleichenden und oftmals verborgenen Veränderungen nicht. Wie soll der Architekt dann zuverlässig planen? Wie soll der Statiker seriös berechnen, ob das Tragwerk hält? Ohne Kenntnis des aktuellen Zustandes können wir schlecht planen. Unser Tun ist vom Glauben an das Richtige geprägt, nicht jedoch von der Gewissheit, auch das Richtige zu tun.
In den 1980er Jahren nahm das Bauen im Bestand in Deutschland allmählich zu. Die Neubauphase der Nachkriegsjahre war zu Ende. Das Interesse an historischen Bauten stieg. Immer häufiger wurden Altbauten saniert. Anfang der 1990er Jahre betrug der Anteil des Bauens im Bestand allein im Wohnungsbau in den alten Bundesländern fast sechzig Prozent.2 Heute hat allgemein das Bauen im Bestand den Neubau überholt.
Bestandskenntnis bildet die Voraussetzung für Entscheidungen, Planungen und Folgenabschätzung: Wie können wir die Grundrissteilung optimieren, so dass sie einer modernen wirtschaftlichen Nutzung entspricht? Welche Mauern können wir abreißen, welche müssen stehen bleiben? Was muss aus statischen Gründen konstruktiv verstärkt werden? Diese Fragen wiegen umso schwerer, wenn der Altbau das Siegel des Denkmalschutzes trägt. Das Denkmal steht unter unser aller Schutz. Und damit der Schutz in einem Rechtsstaat wie dem unseren keine Worthülse bleibt, ist er gesetzlich verankert. Und die Maßnahmen, die daraus für den Erhalt der Denkmäler folgen, fassen wir unter der Denkmalpflege zusammen.
Wenn wir ein Denkmal pflegen wollen, müssen wir wissen, was erhaltenswert ist und was geändert werden darf. Wenn es aber keine Beschreibung gibt, keine Aufzeichnung und keine Begründung des erhaltenswerten Bestandes, wie können wir dann sagen, was erhaltenswert ist und was nicht? Unser Handeln soll pfleglich mit dem Denkmal umgehen. Aber auch wenn wir uns mit Herz und Seele dem Denkmal verbunden fühlen, fehlt uns mitunter die Kenntnis beispielsweise historischer Bauweisen oder bestimmter Materialien. Wie können wir dann behutsam und denkmalgerecht planen und bauen?
Das Bauen im Bestand erfordert von uns dieselbe Sorgfalt, wie sie auch der Chirurg im Krankenhaus an den Tag legt: Bevor er das Skalpell ansetzt, wird er den Patienten gründlich untersucht haben. Wenigstens vertraut man darauf. Auch ein Richter wird vor seinem Urteilsspruch die Sach- und Rechtslage hinreichend geprüft haben. Hoffentlich! Denn sonst herrschte Willkür, und die Folgen wären chaotisch. Nicht chaotisch, aber schon riskant wirkten sich Baumaßnahmen aus, die ohne Bestandskenntnis loslegten: finanziell, denn niemand kann die Investition zuverlässig kalkulieren; statischkonstruktiv, denn wenn eine tragende Mauer abgebrochen wird, können die Folgen fatal sein; kulturell-gesellschaftlich, denn bei Denkmälern kann wertvolle Bausubstanz vernichtet werden. All das soll nicht sein. Verantwortungsvolle Bauherren wollen weder Geld zuschießen noch böse Überraschungen erleben, und sie wollen auch nicht ihr Denkmal gefährden. Darum steht vor jeder Baumaßnahme im Bestand zuerst eine Bestandsaufnahme.
Mit der Bestandsaufnahme historischer Bauten und besonders von Denkmälern befasst sich in Deutschland die Historische Bauforschung. Sie erfasst systematisch die Bauten und ihre Reste, fragt nach der historischen Bauweise und wie sich das Denkmal in die Geschichte einordnen lässt.3 Die Historische Bauforschung schafft mit der Bestandsaufnahme eine wichtige Grundlage gleich für drei Fächer4:
Читать дальше