Benjamin Hofmann - Kapital oder Kurve?
Здесь есть возможность читать онлайн «Benjamin Hofmann - Kapital oder Kurve?» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Kapital oder Kurve?
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Kapital oder Kurve?: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Kapital oder Kurve?»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Benjamin Hofmann analysiert die Gemengelage als einen «clash of cultures».
Kapital oder Kurve? — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Kapital oder Kurve?», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Die Ausgliederung, die dem Stolz des schwäbischen Fußballs im Juni 2017 41,5 Millionen Euro der Daimler AG gegen 11,75 Prozent Anteile aus der VfB Stuttgart 1893 AG in die Kassen spülte, als Spaltpilz? In den Kreisen von Wirtschaftsbossen und Fußball-Vorständen kommen solche Behauptungen gar nicht gut an.
Dort gilt Vogt als Mann der Kurve, als Ultra, als Gefahr. Zu diesem Ruf gelangt er nicht zuletzt aufgrund seiner Mitwirkung im kommerzkritischen Verein „FC Playfair“. „Wir fordern, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, wie die immer weiter fortschreitende Kapitalisierung des Profifußballs in die richtigen Bahnen und einen vernünftigen Rahmen gelenkt wird. Wir fordern mindestens einen Fanvertreter im obersten Kontrollgremium eines jeden deutschen Profifußballclubs.“ Das sind Auszüge aus der Charta des Vereins. Lässt sich schwer vereinbaren mit den Werten eines Klubs, in dem der Sportvorstand kritische Fans gerne mal öffentlich als „ahnungslose Vollidioten“ abkanzelt.
Ist diese Haltung also der Grund, weshalb sich Vogt schon vor der Wahl zum Präsidenten anonymer Rufschädigungen erwehren muss? Hypothetisch. Fakt ist: Am 15. Dezember 2019 wird der Mann seine Rede vor den Mitgliedern halten mit dem erweiterten polizeilichen Führungszeugnis in der Jackettasche. Sicher ist sicher. Vogt befürchtet, dass irgendeines der rund 2000 anwesenden Mitglieder aufsteht und plötzlich jene anonyme E-Mail rezitiert mit all den Rufschädigungen. Da weiß er noch nicht, dass keine 13 Monate später schon sein eigener Vorstandsvorsitzender seinen Ruf mit einer öffentlichen Frontal-Attacke zu zerstören versucht. Es ist die offene Kriegserklärung, Kapital kontra Kurve im Fußball. Welcome to the House of Cannstatt!
KAPITEL 1
Vorgeschichte
Und am Ende steht der Abstieg
Im Kessel brodelt es, und Christian Gentner hat sein T-Shirt nach oben gezogen. Mit einer wilden Grimasse läuft, ja stürmt der Kapitän des VfB Stuttgart zu den Fans. Sein Tor gegen Mainz 05, schon nach sechs Minuten an diesem 7. Mai 2016, ist eine Adrenalinspritze der Hoffnung. Packen sie doch noch den Klassenerhalt, die Schwaben? Schweiß bricht sich Bahn. Saft der Euphorie. Später mischt sich Angstschweiß darunter. 1:3. Noch ist der VfB nicht sicher abgestiegen, doch der Sprung auf Relegationsrang 16 scheint bei zwei Punkten Rückstand schon zu groß für diese Truppe. Der ans rettende Ufer wäre ein Satz vom Ausmaß einer Raubkatze. Keine zwei Stunden nach dem Stoß der Euphorie sitzt Gentner in den Katakomben der Mercedes-Benz-Arena. Hängende Köpfe. Kevin Großkreutz heult. Im Kessel brodelt es.
Doch diesmal sind es Wut und Trauer. Ein Platzsturm, jedoch keiner in marodierenden Hundertschaften, sondern ein halbwegs gesitteter. Keine Massenprügelei, hauptsächlich emotionale Wortgefechte. Zwar kommen die 40, 50, die da über die Absperrung geklettert sind, nicht wie der diplomatische Dienst daher. Doch sind es wirklich diese „unfassbaren Szenen“, die der Sprecher der ARD-Sportschau später in die Wohnzimmer der Bundesrepublik kommentieren wird? „Was geht in diesen Menschen vor?“, fragt er und nutzt den Begriff Lynchjustiz. Nur eine Facette an diesem Abend, aber mit Blick auf die Wirkmacht von Medien in der Deutung bestimmter Vorkommnisse im Fußball ist die Wortwahl des Kommentators schon von Belang.
Tatsächlich sind einige Schubser gegen Profis im Bewegtbild dokumentiert. Philip Heise erwischt es, auch Daniel Schwaab. Nicht entschuldbar, zudem sind manche Platzstürmer martialisch vermummt. Aber ein Lynchmob? Als ein Chaot Großkreutz an die Wäsche will, verteidigen andere Fans den zu Tode betrübten Weltmeister. Den schlotternden Alexandru Maxim nehmen sie gar in den Arm. Von ungefähr dürfte es nicht kommen, dass der Zorn gegen die Profis gar nicht so feurig scheint.
Die Kicker haben sich mittlerweile in die Kabine verzogen. Vor dem Spielertunnel skandiert eine Busladung Platzstürmer in Richtung Ehrentribüne: „Vorstand raus, Vorstand raus.“ Nach und nach tröpfeln mehr von den Tribünen auf den Rasen. Ein paar machen Selfies, ein paar sind besoffen.
„Wenn ihr in die Kurve geht, kommt die Mannschaft“, klingt die Stimme von Stadionsprecher Holger Laser durch die Boxen. Das Angebot, dass sich die Profis stellen, löst ein gellendes Pfeifkonzert aus. Aber es kommt schließlich doch zur Aussprache mit der Mannschaft, zur Diskussion. Ob sie auch den Niedergang aufarbeiteten, der dem ersten Abstieg des VfB Stuttgart seit 1975 vorausging? Nun, das wäre ein abendfüllendes Thema gewesen. Ein Jahrzehnt lang steuert der Traditionsklub auf diese große Katastrophe zu, die eine Woche nach dem 1:3 gegen Mainz Realität wird. Abstieg in die zweite Liga.
Ein beispielloser Abwärtsstrudel hat die Schwaben nach der Meisterschaft 2007 erfasst. Oder besser: Sie haben sich selbst in diesen Sog gemanagt. Der sie unaufhaltsam in die Tiefe gezogen hat. Vom stolzen Südklub in einer der stärksten Wirtschaftsregionen Deutschlands, die eine günstige Sponsorenlage garantieren sollte, zur grauen Maus, zum Absteiger in nicht einmal einer Dekade. Einer Dekade des Dilettantismus.
Fehlerpuzzle
Das Managementversagen im Schnelldurchlauf. Von der Meisterschaft bis zum Abstieg nennen sich satte neun verschiedene Fußballlehrer Trainer des VfB Stuttgart: Armin Veh, Markus Babbel, Christian Gross, Jens Keller, Bruno Labbadia, Thomas Schneider, Huub Stevens, wieder Veh, dann wieder Stevens, Alexander Zorniger, Jürgen Kramny. Parallel verbrennt der Klub unter anderem die – mit unterschiedlichen Titeln ausgestatteten – Sportchefs Horst Heldt und Fredi Bobic. Bobic, der später aus dem Abstiegskandidaten Eintracht Frankfurt einen Klub formen wird, der in die Phalanx der Top-Sechs einbricht, den DFB-Pokal holt und bis ins Europa-League-Halbfinale stürmt, managt den VfB im Tandem mit Jochen Schneider. Das Urgestein spielt bereits seit den frühen 2000er-Jahren eine Rolle im Klub. Gemeinsam mit Veh, der interimsweise eine Doppelrolle ausfüllt, übernimmt Schneider im Herbst 2014 die sportliche Leitung. Bis der Klub im Januar 2015 die (vermeintlich) große Lösung präsentiert: Robin Dutt. Muss ja ein Guter sein, schließlich hatte ihn der DFB im Sommer 2012 zum Nachfolger von Matthias Sammer auf dem Sportdirektorenposten gekürt.
Dass dies für Dutt offenbar nur eine Übergangsstation darstellte, scheint den Handelnden in Stuttgart entgangen zu sein. Kein Jahr später, als Werder Bremen winkt, verlässt Dutt den Verband – wohlgemerkt als Trainer, nicht als Sportchef. Schon zwei Monate vor dem Werben von der Weser sagte er dem „Tagesspiegel“: „Wenn ich die Kollegen von der Tribüne aus am Spielfeldrand sehe, gibt es schon eine gewisse Sehnsucht. Manchmal fehlt mir die frische Luft.“
Das wirft die Frage auf, was Dutt anderthalb Jahre später dazu befähigen soll, ein Schlachtschiff auf Schlagseite wie den VfB wieder auf Kurs zu bringen? Als Sportvorstand, nicht als Trainer. Was möchte Dutt sein? Manager oder Coach? Frische Luft atmet ein Funktionär nicht, eher gefilterte aus Klimaanlagen, wenn es um Vertragsverhandlungen geht. Warum eine solche Person für einen Vorstandsjob verpflichten, die zuvor noch medial mit dieser Rolle gefremdelt hatte und aus einem Direktorenposten im Mai 2013 einem Ruf als Trainer gefolgt war? Zu einem übrigens wenig erfolgreichen Engagement. Werder stellt Dutt bereits im Oktober 2014 frei. Nicht einmal eineinhalb Spielzeiten nach dem großen Tamtam um die Freigabe beim DFB. Es wirkt, als agiere der VfB völlig planlos und engagiere einen Sportvorstand, der selbst nicht so recht weiß, was er möchte. Ab 2018 übrigens arbeitet Dutt wieder als Trainer. Erst beim VfL Bochum, künftig beim Wolfsberger AC in Österreich.
Die hohe Fluktuation auf der Bank und bei den Kaderplanern hinterlässt auch Spuren beim kickenden Personal. Der VfB scheint zum Durchlauferhitzer auf dem Transfermarkt zu mutieren dieser Tage. Zwischen den Saisons 2007/08 und 2015/16 kommen 72 Zugänge von extern nach Schwaben – die vielen Talente aus dem hochgelobten Unterbau sind hier nicht berücksichtigt. Laut dem Branchenportal „transfermarkt.de“ für 98,67 Millionen Euro. Dafür nimmt der Traditionsverein auch 114,55 Millionen Euro ein, 97 Profis verlassen den Klub in diesen neun Spielzeiten. Das sind nun erst einmal nackte Zahlen, mit denen sich wenig anfangen lässt. Der Reiz liegt im Quervergleich.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Kapital oder Kurve?»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Kapital oder Kurve?» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Kapital oder Kurve?» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.
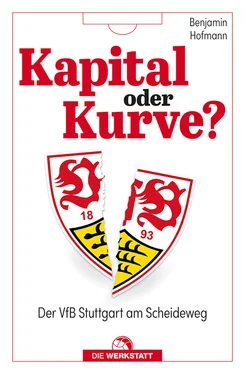
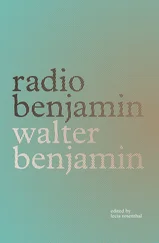
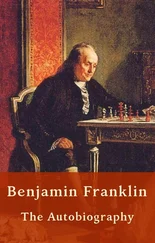

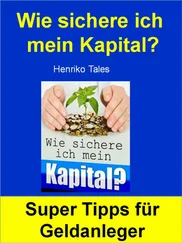


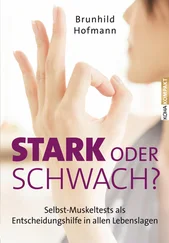


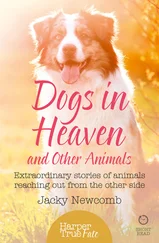
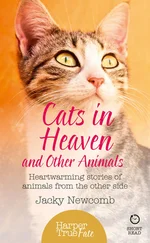
![Benjamin Franklin - Memoirs of Benjamin Franklin; Written by Himself. [Vol. 2 of 2]](/books/747975/benjamin-franklin-memoirs-of-benjamin-franklin-wr-thumb.webp)