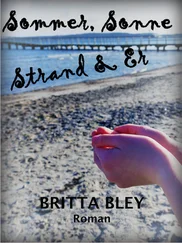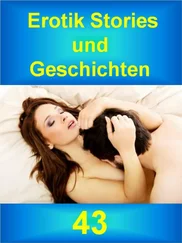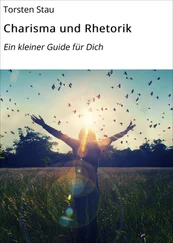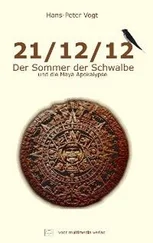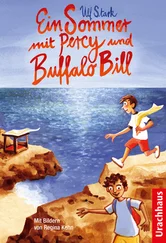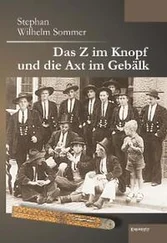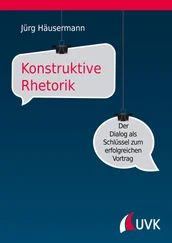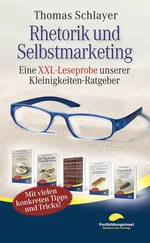Direkt loszulegen, hilft zwar, den Stress nicht weiter wachsen zu lassen. Das Manuskript zu büscheln oder sich in der Elektronik zu orientieren, hat zwar den Sinn, Ordnung zu schaffen. Wer auf das Mikrofon klopft, weiß zwar, dass die Tonanlage funktioniert. Aber die Leute im Auditorium erleben dabei nur eines: einen Menschen, der sich mit sich selbst beschäftigt. Und der sich noch keine Zeit genommen hat, mit ihnen in Kontakt zu treten.
Wie man es auch machen kann, demonstriert Sebastian P. Schild. Er wird gleich vor 60 SeminarteilnehmerInnen reden. Bisher saß er mit dem Rücken zum Publikum da. Jetzt ist er dran, und er rollt seinen Rollstuhl vor die vorderste Reihe, wendet sich den Leuten zu und stoppt. Da sitzt er nun, aufrecht, mit hängenden Armen. Sieben Sekunden lang sagt er nichts, sondern schaut in den Raum. Er sieht nach rechts, sieht nach links. Und erst dann fängt er an.
Es wird ein fulminanter Vortrag mit viel Interaktion, der die Menschen begeistert. Aber der Anfang war ganz einfach besonnen und konzentriert – konzentriert auf das Publikum und auf den gemeinsamen Raum. 50
Wer die Rednerposition eingenommen hat, soll sich die Zeit nehmen, den Raum und die Menschen darin wahrzunehmen. Vielleicht müssen zunächst technische Probleme gelöst werden – vom Kontrollieren der Fernbedienung bis zum Schluck aus dem Wasserglas. Aber dennoch braucht es zusätzlich eine Pause von wenigstens einigen Sekunden, die man dem Raum und dem Publikum widmet. Dazu gehört Blickkontakt mit einer oder zwei Personen, die vielleicht sogar lächeln. Und dazu gehört das Bewusstsein: Dieser ganze Raum steht mir zur Verfügung.
Die Wichtigkeit des Raums ergibt sich schon aus der Definition der Rhetorik als Lehre vom Reden in der Öffentlichkeit: Die Rednerin begegnet den Zuhörenden an einem Ort, der größer ist, mit weiteren Distanzen als beim alltäglichen Gespräch. Dessen muss sie sich bewusst sein, auf diese Voraussetzungen muss sie eingehen.
Den Raum und die Menschen, die darin versammelt sind, wahrzunehmen erfordert Zeit. Die rechtzeitige Auseinandersetzung mit dem Raum schafft nicht nur einen besseren Kontakt. Sie hilft auch auf einer rein technischen Ebene. Man wird sich dem Raum ja in der Redeweise anpassen müssen: in Stil, Lautstärke, Gestik und anderen Äußerungsformen. Zudem stellt jedes Rednerpult, jede Projektionsanlage eigene Anforderungen an das technische Geschick der Vortragenden.
Platz schaffen, Plätze zuweisen
Zur ersten Auseinandersetzung mit dem Raum gehört auch Orientierung. So muss abgeklärt werden, welcher Platz als Rednerposition vorgesehen ist und ob es dazu Alternativen gibt. Auch die Technik, die genutzt wird, und der Ort des dienstbaren Geistes, der sie eventuell bedient, müssen gefunden und ausprobiert werden.
Wer kann, begibt sich deshalb schon vor Beginn der Veranstaltung in den Saal, um diese Fragen zu klären. In vielen Fällen lässt sich da noch die eine oder andere Rahmenbedingung verändern: in kleineren Seminaren die Sitzordnung, in größeren Sälen die Position des Rednerpults. Wesentlich ist immer: Wer vor dem Publikum steht, hat im Prinzip viel mehr Raum zur Verfügung als diejenigen, die im Publikum sitzen. Und er ist für die gemeinsame Nutzung des Raums verantwortlich. Dies gilt für den Instruktor, der seinem Team die Benutzung einer neuen Maschine erklärt, ebenso wie für die Pressechefin, die eine Gruppe von Besuchern durch den Betrieb führt, oder die Referentin, der man einen Sitzungsraum zur Verfügung gestellt hat. Es gilt aber auch für die Lehrerin, die die Schulklasse zur selbständigen Arbeit anleitet, und für den Studenten, der die Resultate einer Gruppenarbeit präsentiert. Sie alle sind frei in der Wahl der Distanz zu den Angesprochenen und in ihrer Raumnutzung, z.B. durch Schritte und Körperdrehungen. In vielen Fällen ist es sogar möglich, mitten durch das Publikum hindurchzugehen. Dass z.B. ein Lehrer die Bankreihen abschreitet, ist eine traditionsreiche Geste, dass ein Referent vor den Zuhörenden auf und abgeht, wird ebenfalls akzeptiert. Alle diese Dinge muss man nicht tun (und einige können auch kontraproduktiv sein); aber zu wissen, dass man es tun könnte, ist ein guter Ausgangspunkt. Es betont die Freiheit der Gestaltung.
 So näherst du dich dem Raum an
So näherst du dich dem Raum an
Vor dem Beginn der Veranstaltung:
»Suche den Raum auf und mache dich mit seiner technischen Einrichtung vertraut.
»Setze dich auf einen Zuschauerplatz, um ein Gefühl für den Eindruck zu bekommen, den man von dort aus vom Redner und dessen Umgebung hat.
»Wähle (wenn möglich) deinen späteren Standort. Gibt es mehrere Möglichkeiten? Solltest du deine Position während der Rede wechseln?
Sogar wenn keine Gelegenheit besteht, den Raum in Ruhe zu erkunden, kann man ein paar Sekunden dafür einsetzen. Man wird zum Beispiel unverhofft zu einer Sitzung gerufen und steht plötzlich vor den versammelten Abteilungsleitern – gefühlt zur falschen Zeit und ohne genügend Vorbereitung.
Hinzu kommt ein mentaler Effekt: Wer sich auf den Raum einlässt, stimmt sich auf die Öffentlichkeit ein, die hergestellt wird, auf die Weitung des Geltungsraums, die das Reden erst zum rhetorischen Akt macht. Ohne ein Bewusstsein für diese Veränderung wird, was man sagt und wie man es sagt, nicht zusammenpassen. Es ist ganz natürlich, dass dieses Bewusstsein für den Raum auch den körpersprachlichen Ausdruck beeinflusst.
 Raumnutzung durch Planung des Ablaufs
Raumnutzung durch Planung des Ablaufs
»Wo sind die Geräte, die ich einsetzen werde?
»Wer hilft mir bei den technischen Abläufen? Wo befindet sich diese Person?
»Wo werde ich stehen? Kann ich meine Position verändern, um die Gliederung des Vortrags zu unterstreichen?
Die Haltung zeigt die Beziehung zum Raum
Wer vor Publikum reden will, muss den Raum einnehmen. Ob dies gelingt, zeigt die Körpersprache, und ein wichtiges Signal gibt dabei die Körperhaltung.
Zwei Skizzen illustrieren dies: Im linken Bild demonstriert die Rednerin Reserviertheit, Inaktivität. Mit der nach vorne gebeugten Haltung scheint sie in ihrem Anzug zu hängen. Die Füße, die eng beieinanderstehen, bieten keinen sicheren Halt. Auf dem Bild rechts hat sie durch einen sichereren Stand und das Heben der Arme bereits eine andere Präsenz. Sie atmet in die Körpermitte (s. Kapitel 7) und ist sich des gesamten Raums bewusst, in dem sie sich befindet. Sie signalisiert allen, die vor ihr sitzen, Interesse.

7 | Passive Haltung: Füße nahe beieinander, Oberkörper ohne Spannung.

8 | Aktive Haltung: Füße in etwa schulterbreitem Abstand, Oberkörper aufgerichtet.
Die Haltung ist nicht nur dazu da, Selbstvertrauen zu signalisieren. Sie hilft auch dabei, die Distanz zu überbrücken: Indem das Publikum einen Menschen sieht, der Präsenz ausstrahlt, konzentriert es sich besser und ist aufmerksamer trotz der Entfernung und der Ablenkungen durch Sitznachbarn und Nebengeräusche.
Kontakt aufnehmen, Kontakt halten
Natürlich hat man das Publikum längst wahrgenommen. Aber kurz vor dem Beginn der Rede braucht es ein paar Sekunden, in denen bewusst Kontakt mit aufgenommen wird – der Kontakt, der durch den Vortrag hindurch gehalten wird. Es ist notwendig, sich dafür die Extrazeit zu nehmen, für Blickkontakt, ohne dabei gleichzeitig einen sicheren Stand zu suchen, ohne noch mit der technischen Einrichtung zu kämpfen.
Читать дальше
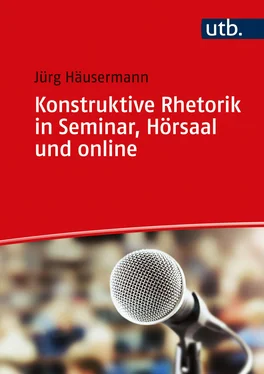
 So näherst du dich dem Raum an
So näherst du dich dem Raum an