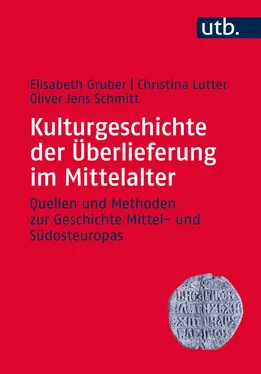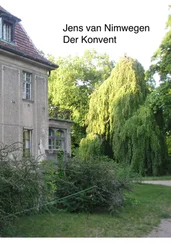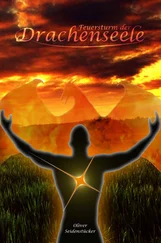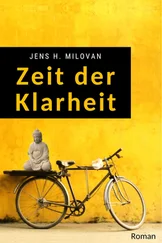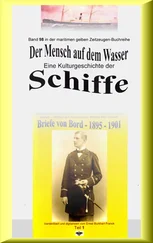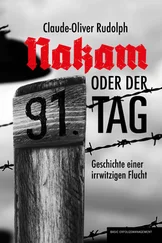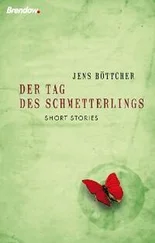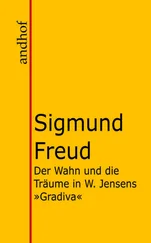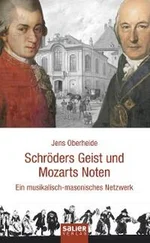Logik der Überlieferung
Sie wird daher zweitens ergänzt und verschränkt mit einer Einführung in die sozialen Räume und kulturellen Milieus, in denen in jedem dieser Zeiträume tendenziell die umfangreichste oder eine deutlich ansteigende Überlieferung zu verzeichnen ist, sowie besonders gute Chancen ihres längerfristigen Bestandes. Das ist für das Frühmittelalter die Kirche als wichtigste Überlieferungsträgerin. Im Hochmittelalter hat die urkundliche Überlieferung auch für die Rechts- und Verwaltungspraxis weltlicher Herrschaftsträger zunehmenden Anteil an der Überlieferung, ergänzt durch die Vielzahl von Objekten schriftlicher, bildlicher und materieller Kultur, die Zeugnis von höfischer und adeliger Repräsentation geben. Im Spätmittelalter kann Stadtentwicklung als paradigmatisch für den enormen Anstieg an zunehmend organisierter pragmatischer Schriftlichkeit und vergleichbaren materiellen Überlieferungsformen gelten.
Auch diese Typologie versteht sich in erster Linie als grobe Orientierungshilfe: Selbstverständlich sind im geistlichen Milieu entstandene Quellen über weite Strecken auch im Hoch- und Spätmittelalter dominant, doch im Zeitraum davor sind sie gemeinsam mit den spärlichen historiographischen Nachrichten aus dem Betrachtungsraum bzw. der fränkischen, langobardischen und byzantinischen Geschichtsschreibung über ihn oft die einzige erzählende Überlieferung. [<<27] Selbstverständlich gibt es auch im Frühmittelalter bereits Urkunden. Sie sind maßgeblich für die Etablierung eines robusten raum-zeitlichen Gerüsts. Richtiggehende Urkundenlandschaften entstehen allerdings in den meisten Regionen erst im Hochmittelalter, wo sie ihrerseits zur Konstituierung des Raumes beitragen. Selbstverständlich gab es pragmatische Schriftlichkeit bereits in den gut organisierten Reformorden des 12. und 13. Jahrhunderts und zunehmend auch in fürstlichen Kanzleien. Die systematische und serielle Überlieferung, die teilweise sogar vorsichtige quantitative Auswertungen möglich macht, ist allerdings besonders charakteristisch für die spätmittelalterliche Stadtkultur.
Die Orientierung an der Logik der Überlieferung und deren zunehmende Dichte, die sich nicht zuletzt in den Proportionen der Kapitel widerspiegelt, ist ungewohnt und liegt teilweise quer zum gewohnten chronologischen Aufbau von Überblicksdarstellungen, der als Rahmen auch diesem Buch zugrunde liegt. In allen Abschnitten werden wir daher zusätzlich zu Überblicksdarstellungen zur Forschungssituation besonderes Augenmerk auf die Diskussion solcher Überlappungen und auf vergleichende Differenzierungen legen.
Fallstudien
Das dritte Strukturprinzip der Darstellung ist jenes der exemplarischen Fallstudien, für die wir teilweise auf die Expertise von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fächern und mit spezifischen Sprach- und Materialkenntnissen zurückgreifen, um der räumlichen und damit auch sprachlichen Heterogenität der Überlieferung in Mittel- und Südosteuropa Rechnung zu tragen. Eine einführende Darstellung wie diese kann dabei nicht enzyklopädisch, sondern nur exemplarisch vorgehen, um die Vielfalt und Komplexität der Gegenstände auch methodisch fassbar zu machen.
Ein kulturhistorischer Zugang zu historischen Quellen fokussiert auf das „Wie“ und „Warum“ ihrer Herstellung, Rezeption und Zirkulation im Kontext von sozialen Lebensformen und kulturellen Vorstellungen. Der Aufgabe einer vergleichenden einführenden Darstellung als Wegweiser oder Orientierungshilfe gerecht zu werden, erfordert daher Schwerpunktsetzungen. „Exemplarisch“ ist angesichts der unterschiedlichen Größenordnungen der vorhandenen Überlieferung daher weniger im Sinn von „repräsentativ“ zu verstehen, sondern mit einem weiteren Begriff von Arnold Esch (1985) als „maßstäblich“: [<<28]
Wie lässt sich die jeweils präsentierte Überlieferung im Vergleich einordnen? Frühe erzählende Quellen wie die Lebensbeschreibung des Hl. Severin aus dem 6. Jahrhundert oder jene der Hl. Method und Kyrill, die dreihundert Jahre später geschrieben wurden, sind für den jeweiligen Überlieferungsraum singulär, während es vergleichbare Quellen im Westen und Süden des ehemaligen Römischen Reichs in deutlich größerer, aber immer noch überschaubarer Zahl gibt und die Überlieferung von Heiligenviten ab dem 12. Jahrhundert sprunghaft anwächst. Aber auch hier ist die räumliche Verteilung im Betrachtungsraum sehr ungleichmäßig. Am eindrücklichsten ist in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts der Gegensatz zwischen Papst Innozenz III. und dem bulgarischen Patriarchen Visarion. Während für das Oberhaupt der römischen Kirche eine enorme Fülle an Urkunden und Registereinträgen erhalten ist, wissen wir von der Existenz seines kirchlichen Gegenübers nur durch eine kurze Inschrift und ein zufällig überliefertes Siegel ( Abb 1). Umfasst das niederösterreichische Urkundenbuch insgesamt über 150 Urkunden in 36 Gruppen bis zum Jahr 1076, das babenbergische Urkundenbuch einige hundert Stück bis 1246, und verzeichnen die Regesten der Bischöfe von Passau für denselben Zeitraum knapp 2000 Dokumente, so gibt es in Bulgarien oder den rumänischen Fürstentümern Walachei und Moldau bis ins 14. Jahrhundert aus unterschiedlichen Gründen (Urkundenverlust, spätes Einsetzen der Urkundenausstellung) nur einige wenige Einzelstücke.

Abb 1 Siegel des Patriarchen Visarion, Siegelabbildung revers, 13. Jahrhundert. [Bildnachweis][<<29]
Ein letztes Beispiel: Um 1200 bildeten europäische Städte wie Rom oder Paris mit fünfstelligen Einwohnerzahlen die Ausnahme. Dazu gehörte auch Venedig, für das in dieser Zeit rund 70.000 Einwohner angenommen werden. Ebenso hat das dichte Städtegeflecht der italienischen Halbinsel oder der spätmittelalterlichen Hanse-Kultur an Nord- und Ostsee keine Entsprechung in Mittel- und Südosteuropa. „Große“ Städte wie Wien oder Prag hatten bis 1500 zwischen 10.000 und 25.000 Einwohner, durchschnittliche Mittel- und Kleinstädte zwischen 2000 und 5000, oft auch weniger. Dalmatien, der westliche Küstensaum Südosteuropas mit einer teilweise noch aus römischer Zeit stammenden Stadtkultur, hatte keine Stadt mit mehr als 10.000 Einwohnern. Selbst die im 15. Jahrhundert blühende Stadtrepublik Dubrovnik/Ragusa, die den Balkanhandel beherrschte und Handelsschiffe bis in das westliche Mittelmeer sandte, gehörte im europäischen Vergleich bestenfalls zu den mittelgroßen Städten. Konstantinopel, die bevölkerungsreichste Stadt Südosteuropas, hatte um 1450 mit zwischen 30.000 und 40.000 Einwohnern einen demographischen Tiefstand erreicht und wurde nach der Eroberung durch Sultan Mehmed II. (1453) u. a. durch gezielte Deportationen aus den Provinzen des Osmanischen Reichs besiedelt.
Die exemplarische Vorstellung einzelner Überlieferungsträger wird daher, wo immer das möglich ist, vergleichend diskutiert, um die Relevanz und Repräsentativität oder eben die Besonderheit der vorgestellten Beispiele deutlich zu machen. Sie werden zudem mit den entsprechenden Verweisen auf einschlägige Handbücher und Forschungsliteratur jeweils in den zeitlichen und räumlichen Kontext eingeordnet. Gleichzeitig werden „weiße Flecken“ auf der Landkarte der Quellenerschließung ebenso sichtbar gemacht wie das Fehlen eines Vergleichsrahmens, wo dies der Fall ist. Schließlich sollen einige Fallbeispiele bewusst konkrete methodische Vorgangsweisen sichtbar machen, mit denen unterschiedliche Fachwissenschaften an ihre Gegenstände herangehen.
Eine kulturhistorische Perspektive
Prägend für das mittelalterliche Europa in seinem allmählichen und „ungleichzeitigen“ Werden waren eine Reihe komplex verflochtener Faktoren. Zwei davon, die – wenn auch vielfach gebrochen – nachhaltig wirksam werden sollten, sind das Christentum und die Auffassung von der sozialen Welt als durch das Prinzip der Ungleichheit [<<30] strukturiert. Man stellte sich die Menschen in Stände hineingeboren vor, die Lebensformen und -chancen wie Handlungsmöglichkeiten maßgeblich bestimmten. Selbstverständlich muss man solche Aussagen umgehend wieder einschränken. Denn das Christentum setzte sich nur allmählich und regional sehr unterschiedlich „tief“ durch, wurde darüber hinaus in einem langen Prozess in einen katholischen „Westen“ und einen orthodoxen „Osten“ geteilt. In ganz Europa lebten im gesamten behandelten Zeitraum Angehörige nicht christlicher Religionen, besonders Juden und Muslime. So gehörten weite Teile unseres Raumes seit der osmanischen Eroberung zu einem Reich, in dem eine überwiegend muslimische Elite nach islamischen Staatsmodellen eine mehrheitlich christliche Bevölkerung beherrschte.
Читать дальше