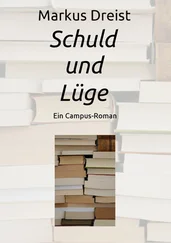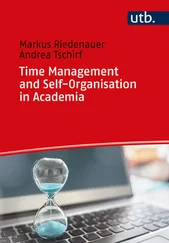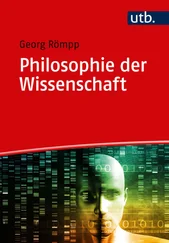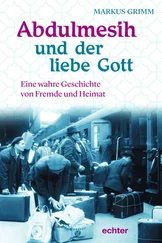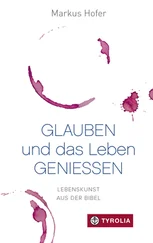Nur wenn Sie selbst unter den gegebenen Bedingungen einigermaßen erfolgreich sind, ohne dabei zu zynisch zu werden, also in einer psychisch gesunden und lebenswerten Weise fortkommen, können Sie längerfristig an deren Verbesserung mitarbeiten.
Darum setzt unser Buch bei Ihnen als Individuum an, um zunächst Ihre Selbstorganisation in der Wissenschaft zu optimieren. Dabei nehmen wir [19]Ihr ganzes Leben in den Blick, um nachhaltig lebbare Methoden, Gewohnheiten und Rhythmen zu entwickeln, die zu Ihrer persönlichen Situation passen. Sich auf Kosten anderer wichtiger Lebensbereiche und -ziele im Beruf zu Höchstleistungen zu motivieren, funktioniert nur punktuell und selten auf Dauer – in der Wissenschaft noch weniger als in der Industrie, wo monetäre und andere Anreize stärker und häufiger wirksam sind.
Das hat Konsequenzen im Großen, im Kleinen und speziell im Bereich der Forschung.
1. Im Blick auf Ihr ganzes Leben auch in seiner zeitlichen Erstreckung sind Sie selbst verantwortlich für Ihre Karriere- und Lebensplanung. Es ist bekanntlich längst nicht mehr so, dass spätestens nach einer guten Promotion eine Assistentenstelle zu erwarten ist, auf der man bis zu Habilitation und/oder Verbeamtung bleiben kann, während der Ordinarius die moralische Verpflichtung spürt, seine „Schüler“ irgendwo „unterzubringen“. Es ist natürlich auch nicht mehr so wie für Immanuel Kant Ende des 18. Jahrhunderts, dass zehn Jahre ohne Publikationen akzeptabel erschienen, während derer ein „Opus magnum“ wie die „Kritik der reinen Vernunft“ erarbeitet werden konnte. Sie müssen wissen, bis wann Sie welche Karriereschritte gehen und was Sie tun wollen, wenn sich die Laufbahn an einem bestimmten Punkt als eine Sackgasse erweist. Das heißt, Sie sollten sich frühzeitig über berufliche Alternativen und deren Vorbereitung Gedanken machen. Sie müssen sich bewusst sein, welchen Preis Sie für die prekäre Freiheit eines Lebens für die Wissenschaft zu bezahlen bereit sind. (Siehe zu diesen großen Fragen besonders das Kapitel II.3.)
Vor allem in der Promotionsphase verfolgen viele knapp Dreißigjährige die Strategie, erst einmal ihr Doktorat zu erwerben, und dann weiterzusehen, ob sich irgendwelche Türen öffnen. Das hat einen hohen Preis: Das Risiko, sich im vierten Lebensjahrzehnt oder zur Lebensmitte ganz neu orientieren zu müssen, während man auf dem Arbeitsmarkt schon als überqualifiziert, zu spezialisiert oder schlicht als zu alt gilt.
Solange Sie nicht hinreichend sicher sind, dass Ihre wissenschaftliche Karriere klappen wird: Entwickeln Sie mindestens einen alternativen Lebensentwurf, am besten auch im Gespräch mit einer Vertrauensperson oder einem Coach. Das ermöglicht Ihnen, frühzeitig Vorsorge zu treffen durch zusätzliche andere Qualifikationen und Netzwerke, und verhindert, dass Sie später das Gefühl bekommen, Ihr Leben in eine Sackgasse gefahren zu haben.
[20]2. Diese Lebens- und Karriereplanung gehört nicht nur zum Zeitmanagement im großen Horizont, sondern hat über die Motivation Einfluss auf die Zeitgestaltung und -nutzung auch im Kleinen und Alltäglichen.
In den Planungshorizonten von Monat, Woche und Tag dürfen Sie Ihre langfristigen Ziele und Alternativszenarien nicht aus dem Blick verlieren. Wer sich vom jeweils Andrängenden treiben läßt, agiert nicht mehr selbstbestimmt. Denken und planen Sie von oben nach unten: vom Wichtigen zum Dringlichen, von den Werten zu den Terminen, von den großen Projekten zu den kleinen Aufgaben. Schaffen Sie in Ihrem Zeitmanagement Raum und regelmäßige Zeitblöcke für das Reflektieren und Planen selbst sowie zuerst für die größeren und langfristigen Ziele. Ein gegebener Raum für Selbstbestimmung wird nur dadurch erweitert, dass er auch genutzt wird.
Soweit Sie selbst über Ihre Zeit verfügen können, passen Sie die Zeiteinteilung auch an Ihre individuellen Ziele und Werte, an Ihren persönlichen Verhaltensstil und an Ihre Lebenssituation an (siehe Kapitel II). Selbstverständlich ist dabei die spezifische Wissenschaftskultur in Ihrem Fach und an Ihrem Institut ebenfalls zu berücksichtigen.
Wie hohe Umsetzungschancen traue ich meiner eigenen Planung und Selbstbestimmung zu? Bin ich vielleicht bereits in einer Opfer-Mentalität gefangen und lasse mich vom „Wissenschaftsbetrieb“ treiben?
Kann ich die Frage beantworten, was ich tun würde, wenn der nächste Karriereschritt misslingen sollte? Und was tue ich heute schon für diese Eventualität?
Setze ich meine großen Ziele auch in den kleineren Planungshorizonten um?
3. Die Planung von Forschungsarbeiten erfordert, Grundregeln des Projektmanagements zu kennen und anzuwenden. Vor allem bei Teamwork, aber auch in der Alleinverantwortung für ein Forschungsprojekt gilt es, von der Sache her, also objektiv sich ergebende Phasen in ihrer logischen Abfolge zu identifizieren und zu planen. Wo kein Forschungsexposé und Zeitplan vorzulegen waren, um etwa eine Förderung zu erhalten, sollten Sie sich das dennoch in Tabellenform erarbeiten (siehe Kapitel VI.1). Wenn Sie die einzelnen Phasen und Teilziele mit Zieldaten versehen und das in die chronologische Planung in Kalenderform integrieren, berücksichtigen Sie auch die Erfordernisse Ihrer subjektiven Lebenslage und „private“ Lebensziele wie außerwissenschaftliche Qualifikationen, Partnerschaft und Familie, andere Interessen und Tätigkeiten, welche für Sie Sinn stiften, Rekreation und Motivation bereitstellen. Wie das geht, erfahren Sie in diesem Buch vor allem ab Kapitel II.3.
| [21]II. |
Spezifische Herausforderungen – Individuelle Bedingungen |
Worum es geht:
Die spezifischen Herausforderungen in der Wissenschaft ergeben sich nicht nur aus institutionellen Rahmenbedingungen, sondern vor allem aus individuellen Faktoren. Auch diese müssen in Rechnung gestellt werden, damit einzelne Methoden der Selbstorganisation nachhaltige Verbesserungen bewirken können. Dazu gehören ein Bewusstsein der eigenen Werte und Klarheit über dadurch bestimmte Rollenbilder, Selbsterkenntnis in Bezug auf individuelle Verhaltenspräferenzen und die Berücksichtigung des ganzen Lebenshorizonts, innerhalb dessen alle großen Lebensziele zu integrieren sind.
„Wir haben nicht zu wenig Zeit, aber wir verschwenden zu viel davon. Auch zur Vollbringung der größten Dinge ist das Leben lang genug, wenn es nur gut angewendet wird.“
Seneca: Von der Kürze des Lebens 1
| 1 |
Orientierung durch Wertbewusstsein und Rollenklarheit |
Worum es geht:
Werte steuern Lebensweisen und Entscheidungen und geben Orientierung für das Denken und Handeln des Menschen. Sie prägen die Identität und werden in Zielen operationalisiert. Persönliche Werte entstehen schon sehr früh durch das soziale Umfeld, meist Elternhaus und Schule, und entwickeln sich später weiter aus einer fortlaufenden Wahl und Gewichtung, geformt durch eigene Erfahrungen und Lebensumstände. Wie Sie die Welt und die Menschen sehen, Ihre Zeit gestalten, welchen Arbeitsplatz in welcher Organisation Sie wählen, wie Sie Entscheidungen treffen, wie Sie Ihren Neigungen nachgehen, Ihren Beruf ausüben, die Art und Weise, wie Sie mit Kollegen und Kolleginnen umgehen, sich in ein Team einfügen oder es führen, hängt sehr von den eigenen Werten ab.
Sie brauchen eine Vorstellung davon, was Ihnen wirklich wichtig ist, um mit sich, den getroffenen Entscheidungen und Ihrem Lebensstil im Reinen zu sein. Wenn es Ihnen gelingt, Ihre Werte in der Arbeit zu leben, wird sie Ihnen Freude, Befriedigung und Erfolg bringen. Das Gleiche gilt für Ihr Privatleben.
Unsere Gesellschaft wandelt sich rasch, und entsprechend ist viel von einem generellen Wertewandel zu hören, mit der allgemeinen Tendenz von Pflichtwerten hin
Читать дальше