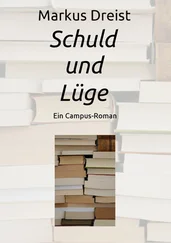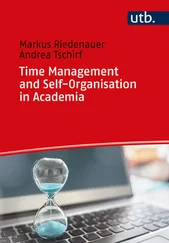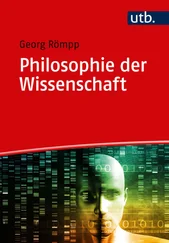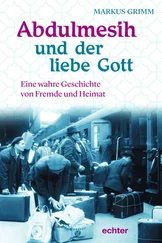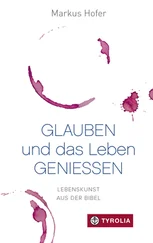Viele sind seit ihrer Studienzeit daran gewöhnt, ihren Tagesablauf weitgehend selbst zu bestimmen, viel daheim arbeiten zu können, auch unter der Woche Besorgungen, Arztbesuche oder anderes zu erledigen und dafür am Abend oder am Wochenende zu arbeiten sowie in den vorlesungsfreien Monaten wenige Termine zu haben. Sie würden sich wohl häufig schwer tun mit einer Kernarbeitszeit von 9 bis 17 Uhr, mit Präsenzpflicht im Büro, den täglichen Arbeitswegen zu Stoßzeiten und dem Zählen eines jeden frei[12]en Tages. 1Da diese Freiheit in zeitlicher Hinsicht bedeutet, dass Tage, Wochen und Monate kaum von außen strukturiert sind, dass wenig Kontrolle und Rückmeldungen über effektive Zeitnutzung erfolgen, erweist sie sich besonders für junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen oft als eine Falle. Wir kommen gleich auf die sehr hohen Ansprüche an die Selbstorganisation und Selbstverantwortung zu sprechen.
Im Bereich der Forschung ist teilweise noch eine große Freiheit bei der Themenwahl gegeben. In manchen Geisteswissenschaften oder der Kunst etwa geben die Betreuenden einer Dissertation o.Ä. auch wenig Hilfestellung beim Finden und Formulieren eines machbaren Forschungsthemas. Trotz der Bemühungen mancher Universitäten, das Doktoratsstudium besser zu strukturieren, wird bereits in dieser Phase oft viel Zeit verloren. In naturwissenschaftlichen, wirtschaftlichen, technischen und medizinischen Fächern hingegen werden häufig mögliche und gewünschte Themen für Bachelor-, Master- oder Diplomarbeiten sowie Dissertationen vorgegeben, besonders dann, wenn damit eine Finanzierung etwa durch Drittmittel verbunden ist. Professoren und Lehrstuhlinhaberinnen genießen dann wieder größere Freiheiten und bestimmen ihrerseits den Freiheitsspielraum für den wissenschaftlichen Nachwuchs mit.
Größere Forschungsprojekte, wozu selbstverständlich auch schon Dissertationen zählen, haben außerdem meist wenig an zeitlicher Binnenstruktur vorgegeben. Wo nicht in gut organisierten Teams gearbeitet wird, sondern überwiegend alleine, wo nicht begrenzte und fixe Zeiten im Labor vorgegeben sind, muss man sich den langen Zeitraum von mehreren Semestern oder Jahren selbst sinnvoll gliedern, sein Projekt in entsprechende Teilschritte zerlegen und sich Teilziele mit Zieldaten festlegen sowie seine Wochenarbeitszeit einteilen. Termine für regelmäßige Rückmeldungen an Betreuende oder Kollegen kann man sich oft selbst vereinbaren und entsprechend auch leicht verschieben, da diese selten verärgert sind über das Ausfallen einer Besprechung.
Im Bereich der Hochschullehre waltete früher eine große Freiheit schon bei den Inhalten von Vorlesungen und Seminaren, welche der Ordinarius (oder seltener die Ordinaria) souverän „ankündigte“. Das hat sich sehr geändert; besonders durch die Modularisierung und Vereinheitlichung von Studiengängen im Rahmen des Bologna-Prozesses sind die notwendigen Lehrinhalte in allen Semestern weitgehend vorgegeben. Selbst wenn durch die Ausweitung der Pflicht-Lehrveranstaltungen kein Spielraum mehr für Spezialvorlesungen, neue oder alternative Seminare oder Übungen gegeben[13] ist, kann man oft innerhalb des Instituts mit anderen Lehrenden tauschen oder aber schon gehaltene Lehrveranstaltungen wiederholen – möglicherweise mit anderen Schwerpunktsetzungen.
Aber immer noch bleibt eine große Gestaltungsfreiheit in Bezug auf die Methoden und Didaktik: Wie wird der Stoff gegliedert und auf das Semester verteilt, an welchen Punkten wird in die Tiefe gegangen, und wo begnügt man sich mit einem Überblick, welche Beispiele, welche Literatur oder andere Lehrmittel werden ausgewählt, inwieweit werden Methoden des E-Learning, der Partner- oder Gruppenarbeit einbezogen, welchen Raum sollen Diskussionen einnehmen usw.
Diese ein hohes Maß an Selbstdisziplin erfordernden Freiheiten können inspirieren und motivieren, aber auch verunsichern. Teilweise werden sie von anderen Einflussfaktoren beeinträchtigt.
Wie frei bin ich derzeit in Bezug auf Forschung, Lehre und meine Zeiteinteilung?
In welchen Bereichen fühle ich mich eher unfrei?
Wie wichtig sind mir meine Freiheiten, welchen Preis sind sie mir wert?
Herausforderungen
Spezifische Herausforderungen an wissenschaftlich Tätige folgen direkt aus den skizzierten Freiheiten. Eine erste Konsequenz ist, dass der Ertrag von Investitionen an Zeit und Energie im Einzelnen schwer abschätzbar ist und sich Fragen dieser Art stellen:
Welchen Unterschied wird es für den Lernerfolg der Studierenden machen, wenn ich diese Lehrveranstaltung gründlich überarbeite?
Wie wichtig ist es, einen Aufsatz zu einem für mich neuen Themengebiet zu veröffentlichen und somit breitere Kompetenz zu zeigen? Hat es einen Sinn, einen weiteren Beitrag zu verfassen zu einem Thema, über das ich bereits publizierte?
Lohnt es sich, mich in ein Nebenthema meiner Dissertation einzuarbeiten, oder lenkt es mich eher vom Wesentlichen ab?
Kann ich z.B. als Vertreterin des Mittelbaus an meiner Fakultät etwas bewirken, was in sinnvoller Proportion zum Zeitaufwand steht?
[14]Der Erfolg von einzelnen Tätigkeiten sowohl in der Forschung als auch in der Lehre zeigt sich oft erst spät, vielleicht nach Jahren – während allgemein bekannt ist, dass die Zeitinvestition der wesentliche Erfolgsfaktor auch in der Wissenschaft ist. Daraus folgt, wie wichtig es ist, Kriterien für Prioritätsentscheidungen zu haben und sich nicht durch das lange Warten auf Zeichen des Erfolgs demotivieren zu lassen. Je weniger positive Rückmeldungen von außen kommen, je weniger wissenschaftliche Arbeit extern motiviert wird (wie durch überdurchschnittliche Gehälter), umso wichtiger wird es, einerseits seine intrinsische Motivation zu pflegen und andererseits dafür zu sorgen, dass regelmäßig Anreize von außen kommen.
Was bedeutet für mich „Erfolg“ in Forschung, Lehre und administrativer Mitarbeit?
Woran kann ich ihn jeweils messen?
Wann bekomme ich auch „unterwegs“ Rückmeldungen, dass ich auf einem guten Weg bin und Fortschritte mache?
Wo kann ich mir zusätzlich solche ermutigenden Stationen einbauen?
Definieren Sie bei großen Projekten und Aufgaben Teilziele, die Sie zu vorbestimmten Terminen überprüfen, um auch Teilerfolge bewusstzumachen und zu feiern (siehe genauer Kapitel IV, besonders unter „Ziele“ und „Evaluation“)!
Ein Hindernis ist oft, dass die Erwartungen und Qualitätsanforderungen anderer nicht recht klar sind, sodass Sie nicht wissen, wann Ihre Forschung oder Ihre Lehre als erfolgreich gelten kann. Viele, die an einer „master thesis“ oder Diplomarbeit schreiben, und so manche Dissertanten sind sich im Grunde unsicher, was die Kriterien für einen guten Text in ihrem Fall sind. Wo es keine Doktorandengruppe o.ä. gibt, sind kollegiale Rückmeldungen rar, oder man traut sich nicht, immer wieder darum zu bitten.
Was eine gute Vorlesung oder ein erfolgreiches Seminar ausmacht, ist etwas klarer, und neuerdings wird den regelmäßigen Lehrevaluationen größeres Gewicht beigemessen. Das gibt eine Richtschnur. Dennoch bleibt die Frage, was jenseits von Idealvorstellungen Studierender oder jenseits Ihres eigenen Idealbildes als Hochschullehrer bzw. Dozentin die realistischen Zielmarken sind, die zum nötigen und möglichen Zeitaufwand für die Vorbereitung und Durchführung in solch einer vernünftigen Proportion stehen, dass Sie für Ihre anderen Aufgaben auch genügend Zeit und Energie haben.
[15]Diese Fragen müssen Sie selbst beantworten – auch und gerade in dem Fall, dass Sie zu viele oder gar widersprüchliche Erwartungen vermittelt bekommen. Soweit Sie sich durch mangelnde Rückmeldungen und Einschätzungen Ihrer Arbeit durch andere alleinegelassen fühlen, sollten Sie gezielt darum bitten und nicht voller Selbstzweifel im Dunkeln tappen.
Ein gewisses Maß an „trial and error“ scheint zur akademischen Freiheit zu gehören, und Neues auszuprobieren hat einen Wert: subjektiv, insoweit es Freude macht, und objektiv, da so Innovationen entstehen. Sehen Sie aber auch die Grenzen: Routineaufgaben können nach bewährten Mustern und Kriterien erledigt werden. Strapazieren Sie nicht Ihre Kreativität und Zeit in Bereichen, wo andere mit ihrer Erfahrung helfen können.
Читать дальше