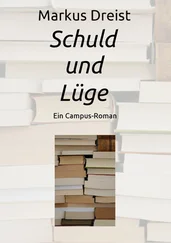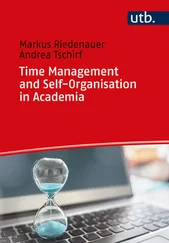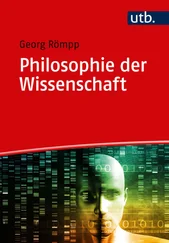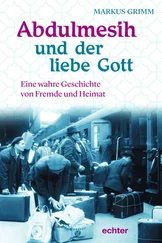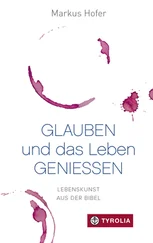Mögliche Rollen: 7
Forschung
Lehre
Autor/Autorin bzw. Herausgeber/Herausgeberin
Organisation von Kongressen und Tagungen
Vortragende/-r
Mentoring
Gutachten
Gremientätigkeit
Führungskraft
Kollege/Kollegin
„Lokalmatador“ oder „global player“?
Private Rollen: Sohn/Tochter, Freund/in, Vater/Mutter etc.
Die meisten Rollen lassen sich noch in Unterrollen aufteilen, die wiederum die unterschiedlichsten und oft völlig gegensätzlichen Anforderungen an Sie stellen. Extrovertiert und Menschen zugewandt in der Lehre, akribisch [26]genau und auch des Alleinseins fähig in der Forschung, rhetorisch brillant und sprachkundig bei Vorträgen, einfühlsam und zielgerichtet zugleich bei Besprechungen und beim Netzwerken, effizient in der Administration... All diese Qualitäten in sich zu vereinen, erinnert an die Forderung nach einem wissenschaftlichen „Wunderwuzzi“, der Sie kaum gerecht werden können. Sie müssen also Prioritäten setzen, die Weiterentwicklung mancher Fähigkeiten in langfristigen Plänen auf später verschieben und Kompromisse schließen. Halten Sie sich an Ihre ganz persönlichen Rollendefinitionen 8und konzentrieren sich auf die Stärken in den einzelnen Rollen, denn nur so können Sie Exzellenz entwickeln.
Welche und wie viele Lebens- und Berufsrollen kann und möchte ich derzeit wahrnehmen?
Wie möchte ich die einzelnen Rollen leben?
Wie werde ich den unterschiedlichen Anforderungen, die die einzelnen Rollen an mich stellen, gerecht? Wo sehe ich meine Stärken, aber auch Schwächen?
Was, glaube ich, erwarten andere (Organisation, Vorgesetzte, Kollegen/ Kolleginnen, Gesellschaft, Familie, Freunde) von mir in diesen Rollen?
Werde ich diesen Erwartungen gerecht bzw. möchte ich das überhaupt?
Wie werde ich mit der Diskrepanz zwischen Erwartungen anderer und meinen eigenen Erwartungen an die unterschiedlichen Rollen umgehen?
Werden Sie sich über Ihre Rollen und Aufgaben klar und wie Sie diese erfüllen möchten, insbesondere wenn Sie sich beruflich (neu) orientieren. Je eher Sie dies tun, umso besser können nicht nur Sie selbst, sondern auch Ihre Umgebung sich darauf einstellen.
Halten Sie sich dabei nicht zu sehr an die Vorstellungen der anderen oder an erlebte Vorbilder, sondern schaffen Sie eine für Sie maßgeschneiderte Lösung.
Nehmen Sie sich regelmäßig Zeit zur Standortbestimmung, priorisieren Sie Ihre Rollen, reflektieren Sie die Ziele, die Sie sich darin stecken. Haben Sie den Mut, Rollen und Aufgaben aufzugeben. Halten Sie sich dabei an das Prinzip: Wann immer ein Bereich dazukommt, wird etwas anderes abgegeben oder reduziert.
Oft liegt die Herausforderung gar nicht in der Vielzahl an Rollen und der Zeit, die sie kosten, sondern in der Energie, die hier investiert wird. Überprüfen[27] Sie also regelmäßig, ob es auch die für Sie selbst wirklich wichtigen Rollen sind, für die Sie die meiste Energie aufbringen.
Das Leben ist natürlich häufig ein Kompromiss. Gegen den Strom zu schwimmen, kostet oft unnötig Kraft. Überlegen Sie daher, wo Sie Kompromisse machen können und wollen. Bedenken Sie aber auch, dass ein Leben gegen die eigenen Werte und Vorstellungen auf Dauer zu Unzufriedenheit oder sogar Burnout führen kann.
Wertediskrepanzen
Wann immer Sie berufliche Entscheidungen zu treffen haben, sollten Sie die Werte, die in der betreffenden Organisation gelebt werden, überprüfen und mit Ihren eigenen vergleichen. 9Überlegen Sie, in welcher Unternehmenskultur Sie sich wohlfühlen und Ihr Bestes bringen können. Entscheidende Faktoren können etwa die Größe einer Organisation, die Anzahl der Subeinheiten, die Frage der Internationalität, herrschende Strukturen, Verwaltungsabläufe, Hierarchien sowie der Umgang miteinander sein.
Sehr oft werden wissenschaftliche Institutionen im Vorfeld glorifiziert. Da die Beschäftigung mit Wissenschaft einer „besseren Sache“ dient, müssen zwangsläufig auch die Akteure „bessere Menschen“ sein, so die Vermutung des wissenschaftlichen Nachwuchses. 10Umso größer ist natürlich später die Enttäuschung, wenn die beim Bewerbungsgespräch besprochenen, oft sogar in Leitbildern niedergeschriebenen Werte im Alltag nicht gelebt werden. Solche Erfahrungen können sein, dass statt eines Miteinanders Konkurrenzdenken vorherrscht und Entscheidungen nicht auf sachlichen, sondern rein emotionalen oder taktischen Überlegungen beruhen. Es kann aber auch sein, dass sich der Job immer mehr zu einer administrativen Tätigkeit entwickelt, die mit unvorhergesehenen Repressalien eingefordert wird, und dass Habilitierte sich um ihre Zukunft und [28]somit ihren Lebensentwurf betrogen sehen, da mündliche Zusagen von heute auf morgen ihre Gültigkeit verlieren.
Organisationswandel bedeutet sehr oft auch Wertewandel. So berichten unsere Seminarteilnehmer und -teilnehmerinnen immer wieder, dass viele der Qualitäten, deretwegen sie sich für den Arbeitgeber Universität entschieden hätten, verloren gegangen seien. Dies führt zu einer wachsenden Unzufriedenheit, die sich wiederum immer stärker auf die Leistung und das eigene Arbeitsverhalten auswirkt. Es fehlt etwa Zeit für gute Gespräche sowohl fachlicher Natur als auch für Zwischenmenschliches. Unsichere Karriere- und Vertragsverhältnisse sowie zunehmender Druck unterbinden das gemeinsame Denken und Tun, weshalb Wissen und Ideen oft nicht mehr ausgetauscht, sondern im Geheimen entwickelt werden.
Freiheit in der Zeit- und Arbeitseinteilung, selbständiges Arbeiten, Selbstbestimmung sind unserer Erfahrung nach sehr oft Motive, sich für die Wissenschaft und den Arbeitsort Universität zu entscheiden. Wie im Kapitel I. erläutert, erfordert diese Freiheit aber auch ein hohes Maß an Selbstdisziplin und eine Selbstverpflichtung zu den gesteckten Zielen. Was man vermeiden wollte, nämlich die Bestimmung durch andere, bedeutet nun, sich selbst disziplinieren zu müssen. Das heißt, konsequent zu planen, Tagesstrukturen einzuhalten, den wichtigen Arbeiten Priorität einzuräumen und sich nicht in den vielen nebensächlichen Tätigkeiten zu verlieren. Denn oft ist niemand da, der Abgabetermine einfordert, Arbeitsfortschritte wahrnimmt, Probleme bespricht oder ganz einfach im Arbeitsalltag unterstützt. Es fehlt das Feedback, das gerade für junge Menschen so wichtig wäre, um zu wissen, ob man fachlich und auch persönlich auf dem richtigen Weg ist.
Diese Realität führt sehr oft zu einem Verschieben von Fristen und Terminen, zu Selbstzweifeln über den eingeschlagenen Weg und einzelne Tätigkeiten, schließlich zu wachsender Unzufriedenheit mit sich selbst. Die Freiheit im rechten Maß nützen zu können, ist eine Kunst, die es oft erst zu erlernen gilt.
Vergleichen Sie bei beruflichen Entscheidungen Ihre Werte und jene der Organisation. Rechnen Sie aber auch damit, dass es hier zu Änderungen kommen kann. Versuchen Sie gegebenenfalls, mit den veränderten Bedingungen produktiv umzugehen anstatt gegen nicht Veränderbares ständig anzukämpfen.
Jede Sache hat – mindestens – zwei Seiten. Wenn Sie vermehrt mit administrativen Belangen betraut werden, so kostet dies Zeit, aber Sie lernen auch eine Menge dazu (z.B. Projekt- und Personalorganisation, Rechnungswesen[29] etc.), was Ihnen später in einer Leitungsfunktion zugute kommen kann.
Sehen Sie Ihre Situation fallweise mit distanziertem Blick, so als ob jemand anderer betroffen wäre.
Lernen Sie, mit Konkurrenzsituationen umzugehen, Angriffe nicht zu ernst und auch nicht (zu) persönlich zu nehmen. Distanz erweitert Ihr persönliches Handlungsrepertoire und damit Ihre Souveränität.
Bedenken Sie, dass Freiheit und Selbstbestimmung einen Preis haben. Ohne eine gute Planung, materielle Bescheidenheit und Selbstdisziplin werden Sie Ihre Ziele nur schwer erreichen.
Читать дальше