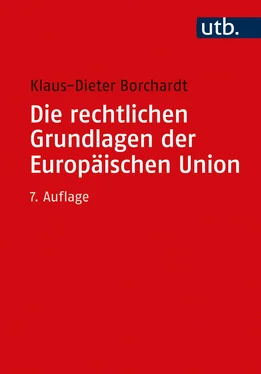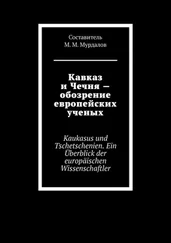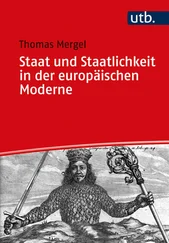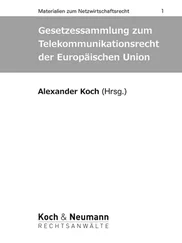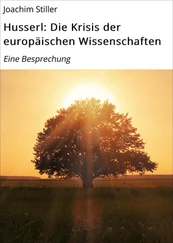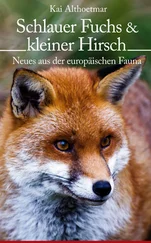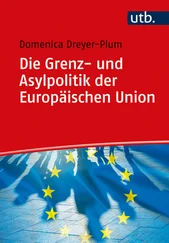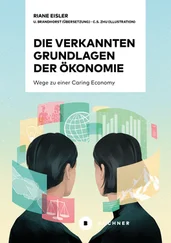§ 4 Die Verfassungsprinzipien
§ 5 Die Organisationsstruktur
§ 6 Funktionen
2. Teil
Die Wirtschaftsverfassung
§ 7 Der Binnenmarkt
§ 8 Die Wirtschafts- und Währungspolitik
3. Teil
Die Grundfreiheiten
§ 9 Der freie Warenverkehr
§ 10 Die Freiheit des Personen- und Dienstleistungsverkehrs
§ 11 Die Freiheit des Kapital- und Zahlungsverkehrs
4. Teil
Der freie Wettbewerb
§ 12 Die Grundlagen des europäischen Wettbewerbsrechts
§ 13 Vorschriften für Unternehmen
§ 14 Fusionskontrolle
§ 15 Kontrolle staatlicher Beihilfen
§ 16 Das Verbot der Begünstigung öffentlicher Unternehmen
5. Teil
Der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts
§ 17 Aufbau des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts
§ 18 Abbau der Kontrollen an den Binnengrenzen und Grenzschutz an den Außengrenzen
§ 19 Justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen
§ 20 Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen
§ 21 Polizeiliche Zusammenarbeit
§ 22 Einwanderungs- und Asylrecht
[S. 8]
[S. 9]
Vorwort zur 7. Auflage
Allgemeines Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Zeittafel
1. Teil 1. Teil Die politische Verfassung der Europäischen Union § 1 Die Entstehung und Entwicklung der Europäischen Union A. Die frühen europäischen Einigungsbemühungen [1] Die Konzeption eines Zusammenschlusses europäischer Staaten ist in der Geschichte des Kontinents fest verankert und hat lange vor Gründung der Europäischen Gemeinschaften in verschiedenen Formen politischen Ausdruck gefunden 1 . Allerdings galt der souveräne Nationalstaat über Jahrhunderte als optimale Organisationsform, so dass die Einsicht in die Notwendigkeit einer Union europäischer Staaten auf vertraglicher Grundlage sich zunächst nicht durchzusetzen vermochte.
Die politische Verfassung der Europäischen Union
§ 1 Die Entstehung und Entwicklung der Europäischen Union
A. Die frühen europäischen Einigungsbemühungen
I. Die Konkretisierung der Europäischen Idee zwischen den Weltkriegen
II. Die Nachkriegszeit
III. Die Gründung der Europäischen Gemeinschaften
IV. Die Bildung der europäischen Freihandelszone
B. Von den Europäischen Gemeinschaften zur Europäischen Union
I. Die vergeblichen Versuche zur Vertiefung der Europäischen Gemeinschaften
II. Die Reformdiskussion der 80er-Jahre
III. Die Einheitliche Europäische Akte
IV. Der Vertrag über die Europäische Union
1. Der Vertrag von Maastricht
2. Der Vertrag von Amsterdam
3. Der Vertrag von Nizza
4. Der Vertrag über eine Verfassung für Europa
5. Der Vertrag von Lissabon
C. Mitgliedschaft, Beitritt und Assoziierung
I. Die Gründerstaaten der Europäischen Gemeinschaften
II. Die Beitrittsgeschichte
1. Der Beitritt des Vereinigten Königreichs, Irlands und Dänemarks
2. Der Beitritt Griechenlands, Spaniens und Portugals
3. Die Eingliederung der früheren DDR
4. Der Beitritt Österreichs, Finnlands und Schwedens
5. Der Beitritt von zehn ost- und mitteleuropäischen Staaten sowie Malta, Zypern und Kroatien
6. Weitere Beitrittsverhandlungen
[S. 10]
a) Beitrittskriterien und Beitrittsverfahren
b) Kandidatenländer
c) Potentielle Kandidaten
III. Die Austrittsgeschichte
1. Grönland
2. Vereinigtes Königreich (Brexit)
a) Austrittsabkommen
b) Politische Erklärung
c) Finale Regelung der zukünftigen Beziehungen
IV. Die (Beitritts-) Assoziierung
§ 2 Ziele, Methoden und Akteure der europäischen Einigung
A. Ziele der europäischen Einigung
I. Die Sicherung des Friedens
II. Die wirtschaftliche Einigung
1. Die Errichtung eines Gemeinsamen Marktes/Binnenmarktes
2. Die schrittweise Annäherung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und die Errichtung der Wirtschafts- und Währungsunion
III. Die politische Einigung
IV. Die soziale Dimension
B. Die Methode der europäischen Einigung
I. Kooperation der Staaten
II. Das Konzept der Integration
III. Verstärkte Zusammenarbeit
C. Die Akteure der europäischen Einigung
I. Die Rolle der Mitgliedstaaten
II. Die Rolle des Europäischen Rates
III. Die Rolle der anderen Unionsorgane
§ 3 Die Rechtsquellen des Unionsrechts
A. Geschriebene Rechtsquellen
I. Das primäre Unionsrecht
1. Die Unionsverträge
2. Änderungs- und Ergänzungsverträge
3. Beitrittsverträge
II. Das sekundäre Unionsrecht
III. Völkerrechtliche Abkommen der EU
1. Assoziierungsabkommen (Art. 217 AEUV)
[S. 11]
a) Abkommen zur Aufrechterhaltung der besonderen Bindungen einiger Mitgliedstaaten der EU zu Drittländern (Art. 198 AEUV)
b) Abkommen zur Vorbereitung eines möglichen Beitritts- und zur Bildung einer Zollunion (Art. 217 AEUV)
c) Abkommen über den europäischen Wirtschaftsraum „EWR“
2. Kooperationsabkommen (Art. 218 AEUV)
3. Handelsabkommen (Art. 218 AEUV)
B. Ungeschriebene Rechtsquellen
I. Allgemeine Rechtsgrundsätze
II. Gewohnheitsrecht
C. Absprachen zwischen den Mitgliedstaaten der EU
I. Völkerrechtliche Abkommen
II. Beschlüsse der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten
D. Schematische Übersicht über die Rechtsquellen des Unionsrechts
§ 4 Die Verfassungsprinzipien
A. Rechtscharakter der Europäischen Union
I. Rechtsnatur der EU
II. Rechtspersönlichkeit der EU
1. Völkerrechtsfähigkeit der EU
2. Mitgliedstaatliche Rechtsfähigkeit der EU
III. Abgrenzung zu anderen Formen politischer Organisation
IV. Verfassungsrechtliche Grundlagen der Integration in den Mitgliedstaaten
1. Die Rechtslage in Deutschland im Einzelnen
2. Die Rechtslage in Österreich im Einzelnen
B. Das Verhältnis zwischen Unionsrecht und nationalem Recht
I. Die Eigenständigkeit des Unionsrechts
II. Das Zusammenwirken der Rechtsordnungen
III. Die unmittelbare Geltung und Anwendbarkeit des Unionsrechts
IV. Der Vorrang des Unionsrechts
V. Die unionsrechtskonforme Auslegung des nationalen Rechts
VI. Schema zur Prüfung der Vereinbarkeit von nationalem Recht und Unionsrecht
C. Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Sozialstaatlichkeit
I. Rechtsstaatlichkeit
[S. 12]
1. Die Gewaltenteilung
a) Prinzip der begrenzten Zuständigkeit
b) Formen der Zusammenarbeit und institutionelle Abhängigkeiten
c) Politisch-parlamentarische Kontrolle
d) Gerichtliche Kontrolle
2. Die Grundrechte
a) Ableitung und Anerkennung der Grundrechte in der Unionsrechtsordnung
b) Grundrechtsträger und -adressaten
c) Schutzbereich der Grundrechte
d) Grundrechtseingriff
e) Rechtfertigung des Grundrechtseingriffs
f) Einzelne Grundrechtsverbürgungen
g) Vorbehalte des BVerfG
h) Vorbehalte des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
3. Rechtsstaatliche Grundsätze
a) Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
b) Grundsatz des Vertrauensschutzes
Читать дальше