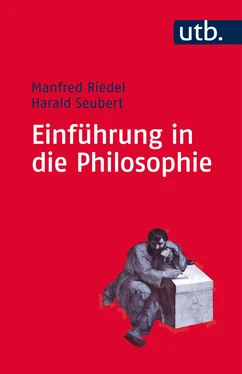Harald Seubert - Einführung in die Philosophie
Здесь есть возможность читать онлайн «Harald Seubert - Einführung in die Philosophie» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Einführung in die Philosophie
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Einführung in die Philosophie: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Einführung in die Philosophie»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Philosophie fragt seit jeher und bis heute nach Wahrheit, dem Guten, der Freiheit und dem Sinn von Sein.
Einzelne untergeordnete Methoden und Disziplinen wie Dialektik, Ethik, Politik und Metaphysik konstituieren sich aus diesen Fragen.
Die Autoren behandeln die Grundfragen und -probleme der Philosophie verständlich und souverän. Sie verdeutlichen den eigenen Charakter der Liebe zur Wissenschaft im Verhältnis zu Weltanschauungen und den Einzelwissenschaften.
Die Einführung will Philosophie nicht nur als Wissenschaft unter anderen zeigen, sondern versteht sie mit Aristoteles als Erste und Allgemeine Wissenschaft.
Einführung in die Philosophie — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Einführung in die Philosophie», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Fragen vom Typ: „Was ist Philosophie?“ sind zweideutig. Sie können einmal besagen: Welche Klasse von Personen bzw. Sätzen benennt das Wort „Philosophie“ – eine wiederum zweideutige Frage, die zweierlei meinen kann; 1. wie es traditionell gebraucht wird, etwa bei Platon oder Kant, bei Heidegger oder Popper, deren Wortgebrauch wir untersuchen und begriffsgeschichtlich vergleichen müssten; 2. kann die Frage meinen, welchen Wortgebrauch wir selbst vorschlagen, und das ist zuletzt eine Definitionsfrage, eine Frage der Festsetzung, die uns erlaubt, „Philosophie“ als „Wissenschaftstheorie“ zu definieren. Aber mit gleichem Recht kann dann der Wissenschaftstheoretiker behaupten: Alles dasjenige, was nicht Theorie der Wissenschaft sei, ist „Mystik“ oder Begriffsdichtung oder Okkultismus. Gleichzeitig weist die Was-ist-Frage über rein terminologische Festsetzungen wie über Begriffsgeschichten hinaus. Wenn wir etwa fragen, was die Zeit oder was der Mensch ist, dann wollen wir nicht wissen, was das Wort „Zeit“ und das Wort „Mensch“ heißt; wir verlangen vielmehr nach Sachkenntnis. Wer so fragt, will also etwas über die Sache wissen, mit der es der Philosophierende zu tun hat. Die These dieser Vorlesung lautet: Die Sache der Philosophie, das sind nicht irgendwelche vorstellbaren Gegenstände, keine Ergebnisse, sondern Aporien, – die Aporien, in die wir geraten, wenn wir die letztlich grundlegenden Fragen stellen, danach, was die Zeit ist oder wer wir selbst sind, die wir in der Zeit leben, einen Anfang und ein Ende haben. „Aporie“, ein griechischer Ausdruck für „Not“ und „Mangel“, bedeutet vorphilosophisch die Bedrängnis desjenigen, der unterwegs ist, die Not eines Reisenden, dem auf der Fahrt durch schwieriges Gelände plötzlich der Weg versperrt ist, daneben auch die Notlage desjenigen, [<<16] der bei der Verteilung von Gütern ausgeschlossen wird oder sonst in irgendeiner Weise zu kurz kommt. In dem Sinn, in dem wir hier das Wort zur Bezeichnung der Sache der Philosophie verwenden wollen, bedeutet „Aporie“ zweierlei: erstens die Verlegenheit, die uns dann überfällt, wenn wir nach den letztlich grundlegenden Dingen fragen, wenn wir an eine Grenze treffen, an der wir nicht weiterkommen, und zweitens den Inbegriff der logischen und hermeneutischen Schwierigkeiten, die uns bei der theoretischen Beschäftigung mit den letztlich grundlegenden Dingen erwachsen, insbesondere dann, wenn die Schwierigkeiten nicht nur als die Erfahrung der Grenze, sondern in der Form des Widerspruchs auftreten. In diesem Falle sprechen wir auch von „Antinomie“. Philosophie, so wollen wir als Erstes festhalten, ist keine Lehre, kein lehr- und lernbarer Bestand von Sätzen und Methoden, sondern die Tätigkeit des Philosophierens. Philosophieren – was immer das heißen mag – ist zunächst und zuerst Fragen-Können, und zwar radikales, an die Wurzel gehendes Fragen.
Hier geschieht etwas sehr Merkwürdiges, nämlich dies, dass sich die Aporie im Doppelsinn der Verlegenheit und logisch-hermeneutischen Schwierigkeit wie von selbst einstellt. Wir brauchen sie nicht zu suchen, sie ist immer schon da, nur wissen wir das nicht, solange wir nicht philosophieren. Ich verdeutliche das an einem Text von Augustin, der den Begriff der Zeit erörtert – radikal, nämlich im Ausgang von einer an den Gottesbegriff der christlichen Theologie gerichteten Frage: Was tat Gott, bevor er Himmel und Erde schuf?2
Das Wissen des Nicht-Wissens in der Bewegung des radikalen Fragens, dass wir auf einmal nicht mehr wissen, was das Wort „Zeit“ bedeutet, dies und nichts anderes, so behaupte ich, ist der Anfang des Philosophierens. Wer philosophiert, ist von dem, was er zu wissen meint, nicht mehr eingenommen. Er findet, was er meint, fragwürdig und setzt das Meinen der Frage aus. Sich der Fraglichkeit einer Meinung öffnen und unvoreingenommen weiterfragen zu können, das ist der Weg zur Philosophie. [<<17]
Philosophie, mit dieser Behauptung möchte ich die Vorüberlegungen abschließen, ist der Versuch einer Antwort auf radikales Fragen, das uns zuletzt vor die grundlegenden Dinge, die Grundfragen unseres Lebens führt. Wie lauten diese Grundfragen? Wenn wir uns dazu in der Philosophie der Gegenwart umsehen, so kommen wir wohl ebenfalls in eine Art von Verlegenheit. Die Grundfrage der Philosophie, so sagen die Anhänger der Dialektik, des dialektisch-historischen Materialismus, ist die Frage nach dem Verhältnis von Denken und Sein. Was ist das Ursprüngliche: der Geist oder die Natur, theologisch variiert: Hat Gott die Welt erschaffen oder ist die Welt von Ewigkeit da? Und je nach dem, auf welche Seite sich eine Philosophie schlägt, ist sie entweder idealistisch oder materialistisch, es gibt nicht eine Philosophie, sondern grundsätzlich und notwendig zwei Philosophien3 (vgl. F. Engels, L. Feuerbach, 1888, Ww 21). Die Anhänger der Hermeneutik sehen hierin gar keine radikale, keine ursprünglich gefragte Frage. Weil diese Fragestellung die geschichtliche Motivation des philosophischen Fragens überspringt, bringt sie immer schon die Eingenommenheit von einer Meinung, den Dogmatismus einer abgeleiteten, sekundären Antwort ins Spiel. Die Philosophie, so entgegnet der Hermeneutiker, bezieht sich unmittelbar weder auf das Denken noch auf das Sein, sondern auf Sprache. Ihre Grundfrage ist das Verhältnis der Sprache, die wir sprechen, zum Text. Wie verhält sich das Gespräch, das wir sind, zur Tradition, aus der wir kommen? Philosophieren, sagt Hans-Georg Gadamer, heißt Wiedererkennen, nämlich so, dass es als Antwort auf eine Frage verstanden wird, die durch die Aussage des Textes erst geweckt wird.4 Die These, dass Philosophie nichts anderes als Wiedererkenntnis des Erkannten, die Hermeneutik von Texten, [<<19] sei, bringt ihrerseits einen Dogmatismus ins Spiel, nämlich die Eingenommenheit von der Tradition. Unter dieser Voraussetzung entfällt das radikal-ursprüngliche Fragen, da die hermeneutische Fragestellung abgeleitet oder sekundär ist: Sie richtet sich auf die Sprache der Texte und nicht auf die Sache, die infrage steht. Wenn dem so wäre, hätten die Analytiker, die Anhänger der dritten Position der Gegenwartsphilosophie, wahrscheinlich recht mit der These: Die Philosophie entspringt den Verhexungen unseres Verstandes durch die Sprache. Die meisten Sätze und Fragen, heißt es im ‚Tractatus logico-philosophicus‘, „welche über philosophische Dinge geschrieben worden sind, sind nicht falsch, sondern unsinnig. Wir können daher Fragen dieser Art überhaupt nicht beantworten, sondern nur ihre Unsinnigkeit feststellen. Die meisten Fragen und Sätze der Philosophen beruhen darauf, daß wir unsere Sprachlogik nicht verstehen (sie sind von der Art der Frage, ob das Gute mehr oder weniger identisch sei als das Schöne). Und es ist nicht verwunderlich, daß die tiefsten Probleme eigentlich keine Probleme sind.“5
Dem letzten Satz von Wittgenstein möchte ich zustimmen; er hätte hier nur unterscheiden müssen. „Problem“ ist die lösbare Aufgabe, eine Streitfrage, die wir entscheiden, ein Rätsel, das wir entschlüsseln können, nämlich dann, wenn wir uns der Mittel und Methoden der Wissenschaften bedienen. Was für Wittgenstein die „tiefsten Probleme“ sind, sind die mit wissenschaftlichen Mitteln und Methoden unlösbaren Aufgaben der Philosophie, die im Wesentlichen ein Vierfaches betreffen: die Frage nach der Wahrheit (1), die Frage nach dem Guten (2), die Frage der Freiheit (3) und zuletzt die Sinnfrage (4). Was hat es eigentlich mit dem Sein in seinen verschiedenen Bedeutungssinnen auf sich? Warum ist überhaupt etwas und nicht nichts (Heidegger)? Kant hat die Grundfragen in die Formulierung gefasst: 1. Was kann ich wissen? 2. Was soll ich tun? 3. Was darf ich hoffen? Nach Kant verweisen diese Fragen auf die Frage nach uns selbst: Was ist der Mensch? Ich denke, dass Heideggers Formulierung radikaler ist: Sie reicht an die Wurzel aller Fragen: Was [<<19] heißt uns Menschen danach fragen, was ist? Letztlich grundlegend ist die Seinsfrage: Was ist der Sinn von Sein? Es sind die Probleme, die Wittgenstein, obwohl er sie für die tiefsten hält, durch Sprachkritik zum Verschwinden bringt. „Wir fühlen“, heißt es am Schluss des ‚Tractatus‘, „daß selbst, wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind. Freilich bleibt dann eben keine Frage mehr; und eben dies ist die Antwort.“6 Ist damit wirklich alles geklärt? Ich denke nicht. Der Wittgenstein des ‚Tractatus‘, der gegen die Philosophie geschrieben worden ist, kann für dieses Werk immerhin nicht auf einen der philosophischen Grundbegriffe, den Begriff der Wahrheit, verzichten. Er hält die Wahrheit seiner Sätze für unantastbar und definitiv, um sie wenig später gleichwohl selbst anzutasten und zu revidieren – das klassische Zeugnis dafür, dass die Grundfragen der Philosophie unhintergehbar sind, und zwar auch dann noch, wenn man, wie Wittgenstein, gegen die Philosophie philosophiert. Dem Philosophieren gegen die Philosophie kommt jedoch ein höchst wichtiges Verdienst zu. Er hat die radikal-philosophischen Grundfragen noch einmal radikalisiert, indem er die Philosophie selbst dem Fragen ausgesetzt hat. Was für eine Tätigkeit ist das Philosophieren? Mit welcher Art von Problemen hat es der Philosoph zu tun? Und wie geht er bei seinem Geschäft vor? Der erste Philosoph, der diese Fragen gestellt hat, war Sokrates. Wittgenstein hat sie nur sprachkritisch radikalisiert, sodass sich inzwischen sogar Berufsphilosophen mehr Gedanken über ihren Beruf machen als zuvor. Es ist die Gegenbewegung zur Philosophie, die sie in unserem Jahrhundert selbst fraglich gemacht hat. Diese Bewegung geht in unserem Jahrhundert von zwei Seiten aus: vonseiten der Wissenschaft, genauer: der Naturwissenschaft und Sozialwissenschaft und vonseiten der Weltanschauung, genauer: der Ideologie. Damit komme ich zum ersten Teil der Vorlesung. Ist Philosophie Wissenschaft oder Weltanschauung? Oder ist sie beides in einem, eine „wissenschaftliche Weltanschauung“, wie der dialektisch-historische Materialismus den Begriff „Philosophie“ definiert? [<<20]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Einführung in die Philosophie»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Einführung in die Philosophie» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Einführung in die Philosophie» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.