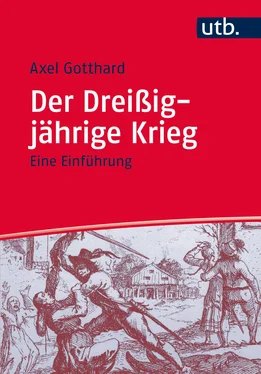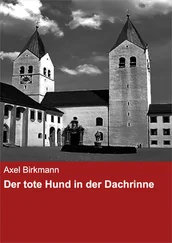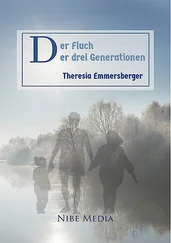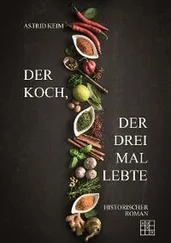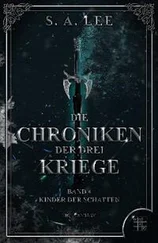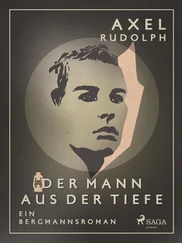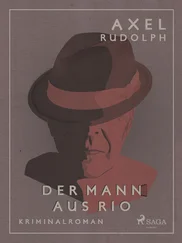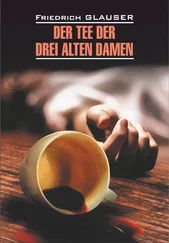Katholische Truppen marschierten 1607 auch in Donauwörth ein, mit besonders gravierenden Folgen für diese Stadt. Die schwäbische Kommune (Donauwörth lag im Schwäbischen Reichskreis) war überwiegend evangelisch, doch schützte der Religionsfrieden den [<<27] kleinen katholischen Rest, ein gutes Dutzend Familien. Von Dillinger Jesuiten angefeuert, nahmen sie ihre Prozessionen zu verschiedenen Kirchlein des Umlands wieder auf. Dabei mussten sie zwangsläufig über Stadtgebiet ziehen, keinesfalls unumgänglich indes war die mit fliegenden Fahnen eingeschlagene Route über den Marktplatz. Das musste Pöbeleien provozieren, weil Protestanten Prozessionen zutiefst ablehnten – sie waren es ihrem Seelenheil schuldig, derlei vor der eigenen Haustüre nicht zu dulden: also Prügelszenen, die Fahnen wurden durch den Straßenkot geschleift, so aus katholischer Sicht natürlich entweiht. Der zuständige Fürstbischof schaltete den – durch und durch katholischen – Reichshofrat ein, das kaiserliche unter den beiden obersten Reichsgerichten. Der Gerichtshof entschied, wenig überraschend, für die katholische Seite. Nach erneuten Prozessionen, erneuten Tumulten verhängte er 1607 die Reichsacht über die Stadt.
Kaiserliche Rechtsbeugung: der Skandal um Donauwörth
Mit der Exekution beauftragte Kaiser Rudolf nicht etwa den eigentlich zuständigen Obristen des Schwäbischen Reichskreises („Landfriedensschutz“, wie man das damals nannte, war Kreissache), also den lutherischen Herzog von Württemberg, sondern Maximilian von Bayern: für alle Protestanten ein himmelschreiender Rechtsverstoß! Wie konnte man sich unter solchen Umständen noch auf den Rechtsschutz des Reiches verlassen? „Donawörth ist ein lumpennest, was hat es aber für ungelegenheit und weiterung causirt“, also verursacht: so seufzte mit Zacharias Geizkofler einer der klügsten politischen Beobachter der Zeit. Der Bayernherzog exekutierte demonstrativ robust, okkupierte die Kommune mit Truppenmacht, übergab die Pfarrkirche den Jesuiten und unterwarf die Reichsstadt seiner angeblich „kommissarischen“ Verwaltung. Daraus wird nie mehr Selbstverwaltung, Donauwörth mutiert zur bayerischen Landstadt. All das musste Deutschlands Protestanten empören, auch, und zumal in Süddeutschland, ängstigen.
1.2.4 Das politische Grundvertrauen schwindet dahin
Es waren aber nicht nur Einzelbestimmungen des Religionsfriedens umkämpft. Wert, Sinnhaftigkeit, ja, Legitimität eines interkonfessionellen politischen Friedens wurden vielmehr seit den 1580er-Jahren in immer mehr Flugschriften (also auf Massenwirkung abzielenden Broschüren zu tagesaktuellen Themen) und gelehrten Abhandlungen [<<28] ganz grundsätzlich infrage gestellt. Ein solcher Frieden wurde immer mehr Autoren zum Inbegriff politischer Hybris, die dem Irrglauben erlegen war, Politik könne mehr sein als Ancilla theologiae (wörtlich übersetzt: „Magd der Theologie“ – also praktische Politik als Vollzug theologischer Postulate, Politikwissenschaft als theologische Hilfswissenschaft).
Fundamentalkritik am Religionsfrieden
Die Fundamentalkritik am Religionsfrieden gipfelte in diese – nun bei katholischen Autoren häufig begegnende – publizistische Position: „Der Augsburger Religionsfrieden bindet uns schon deshalb nicht, weil Vereinbarungen mit Ketzern grundsätzlich keine Rechtskraft zukommt.“ Die damals jedem Gebildeten geläufige lateinische Überschrift für derartige Erwägungen lautete „fides haereticis servanda“ – so also hat man die beliebte Streitfrage rubriziert, ob man denn überhaupt verpflichtet sei, mit Häretikern getroffene Vereinbarungen einzuhalten. „Haeretici“, das waren natürlich die Protestanten, und die waren denn auch zu Recht alarmiert.
„Fides haereticis servanda“
Es entspann sich eine rege publizistische Kontroverse darüber, ob der konfessionelle Widerpart überhaupt noch politikfähig, noch geschäftsfähig sei. Beide Seiten warfen einander in Hunderten von Flugschriften und Traktätchen vor, sich nicht an einmal getroffene Vereinbarungen zu halten, überhaupt halten zu wollen. Frohgemute Bekenntnisse zu mangelnder Vertragstreue begegnen bis in die Kriegsjahre hinein nur von katholischer Seite, aber den Vorwurf an den Widerpart, sich nicht durch Eid oder Vertragsunterschrift gebunden zu sehen, erhoben nun alle Seiten gewohnheitsmäßig. Apodiktisch hielt 1614 ein calvinistischer Autor fest: „Cum ejusmodi hominum genere … contrahi non potest“, Menschen dieses Schlags sind nicht geschäftsfähig. Umgekehrt wussten zahlreiche katholische Autoren, dass von Protestanten grundsätzlich „keine Constitutiones, keine Pacta, Brief vnd Siegel nicht gehalten“ wurden – so eine katholische Abhandlung aus demselben Jahr 1614.
Natürlich lasen die Entscheidungsträger solche Schriften. Für Wilhelm Ferdinand von Efferen, einen im frühen 17. Jahrhundert bekannten katholischen Spitzendiplomaten, waren es „verlauffene Zeiten, da Treue und Glaube noch gehalten worden“, da für evangelische Politiker noch „Eyd, Pflicht, Verschreiben, Versprechen und dergleichen humanae fidei vincula“ gegolten hätten. Protestanten konnte man [<<29] einfach nicht trauen. Gehörten sie, recht besehen, überhaupt jener Wertegemeinschaft des christlichen Abendlandes an, außerhalb derer allenfalls vorübergehende Pax iniqua herrschen konnte, ein Waffenstillstand bis auf bessere Gelegenheit, doch niemals Frieden? Johann Schweikhard von Mainz, wahrlich kein Zelot unter den geistlichen Reichsfürsten der Vorkriegszeit, lamentierte einmal in einem Schreiben an den wichtigsten Berater des Kaisers Matthias (1612–1619), Melchior Khlesl: Es hätten „Ongehorsamb, Ontreu, Betrug und List uber Hand genommen, dass sich weder auf teuere Wort, Vertrösten und Versprechen, noch auch Brief und Siegel, ja den Schwur und Eid selbsten ichtwas zu verlassen, sonder daß alles nach der verfluchten Lehr des Machiavelli auf ein jede sich an Hand gebende Occasion ratione status (wie sie es nennen)“, also unter Berufung auf die „Staatsräson“, „bei Seit gesetzt und nichts geacht wird“. Im lautstarken publizistischen Getöse um die Bindewirkung interkonfessioneller Abmachungen drohte sich das für den Politikbetrieb unabdingbare Grundvertrauen in die Verlässlichkeit der Mitakteure zu verflüchtigen.
1.3 Seit 1608 – die Vorkriegszeit
1.3.1 Krisenjahr 1608
Die Frage, ob politischer Interessenausgleich ohne solches Grundvertrauen überhaupt funktionieren kann, stellte sich mit voller Schärfe seit 1608. In diesem Jahr scheiterte spektakulär und mit weitreichenden Folgen der in Regensburg angesetzte Reichstag.
Reichstag in Regensburg
Klären wir kurz einige im Folgenden wichtige Begriffe: so insbesondere die Termini „Reichstag“ und „Reichsabschied“! Der Reichstag war, modern formuliert, das Legislativorgan des Reiches sowie überhaupt sein zentrales politisches Forum. Er tagte unregelmäßig, alle Reichsstände durften teilnehmen bzw. einen Vertreter abordnen. „Reichsstand“ war, wer „reichsunmittelbar“ war, also lediglich „Kaiser und Reich“, nicht aber einem anderen Landesherrn unterstand; sowie „Sitz und Stimme“ am Reichstag besaß (wo keine Reichsritter saßen und votierten – sie also waren zwar „reichsunmittelbar“, aber doch keine „Reichsstände“). Meistens stand die Reichsstandschaft [<<30] einer einzelnen Person zu: einem Kurfürsten, Fürsten oder Grafen. Im Fall der Reichsstädte besaß ein Gremium die Reichsstandschaft: der Stadtrat der betreffenden Kommune nämlich. Am Ende jedes Reichstags fügte die Kanzlei des Kurfürsten von Mainz, der sozusagen der ‚Reichstagsdirektor‘ war, alle von der betreffenden Tagung erarbeiteten „Reichsschlüsse“ (also, modern gesagt, alle von ihr beschlossenen Gesetze) zu einem langen Text zusammen: dem „Reichsabschied“ dieses Reichstags.
Читать дальше