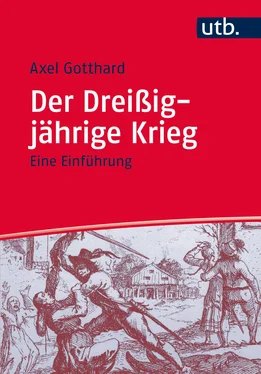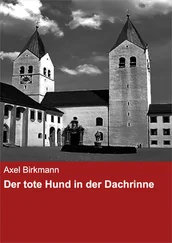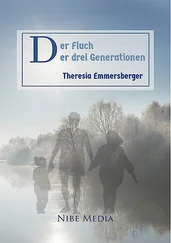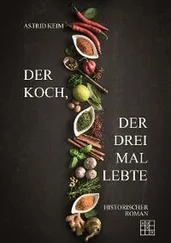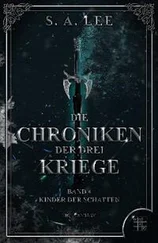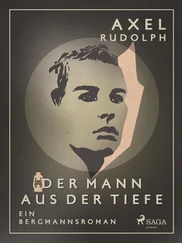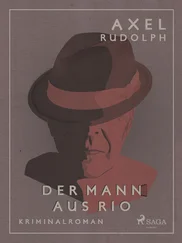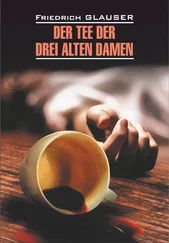Es wurde also bald nach 1555 strittig, ob sich die Wahlfreiheit der regionalen Obrigkeiten auf zwei oder aber auf drei Konfessionen erstrecke. Die meisten Streitigkeiten drehten sich freilich nicht um das einfache regulative Grundprinzip des Religionsfriedens („cuius regio, eius religio“), sondern um komplizierte Sonderbestimmungen, die das obrigkeitliche Ius reformandi einschränkten oder doch in einem Spannungsverhältnis zu ihm standen.
Landsässiges Kirchengut
Die vielleicht komplizierteste Sonderbestimmung thematisiert das Los der landsässigen geistlichen Güter unter protestantischer Landeshoheit. Zunächst einmal: Um was handelt es sich da überhaupt? Es geht um Klöster, Grund in klösterlichem Besitz, fromme Stiftungen und kirchliche Einrichtungen aller Art (von der Schule bis zum Waisenhaus), die landsässig waren, also nicht reichsunmittelbar. Es geht, mit anderen Worten, nicht um geistliche Fürstentümer, [<<24] sondern um all das, was der katholischen Kirche (modern formuliert) privatrechtlich, vermögensrechtlich gehörte, politisch indes irgendeinem Landesherrn unterstand – demjenigen, in dessen Territorium die betreffende Einrichtung eben lag; einem Landesherrn, der sich für die neue Lehre entschieden hatte. Welches Problem sollte unsere Sonderbestimmung lösen? War ein Landesherr evangelisch geworden, war dem das Land mit seinen Einwohnern mehr oder weniger rasch gefolgt – aber darin eingesprenkelt, wie lauter kleine Inselchen, lagen alle möglichen Besitzungen jener katholischen Kirche, von der sich das Land ja gerade losmachte. In den Klöstern beispielsweise wurde Gott in einer Art und Weise verehrt, die nach regierungsamtlicher Auffassung grundverkehrt war. Angesichts der damals ganz selbstverständlichen innigen Verschmelzung von Glauben und Politik meinten die Landesherren, so etwas keinesfalls dulden zu können, wenn ihre Landeshoheit noch etwas wert sein sollte. Deshalb waren die Besitzungen der katholischen Kirche in Gebieten, die evangelisch wurden, denn auch mehr oder weniger rasch und konsequent von der öffentlichen Hand eingezogen und „gemeinnützigen“ Zwecken zugeführt worden. Aber war das legal? Das eben war das Problem!
Und was sagt nun der Religionsfrieden dazu? Nur eines ganz klar: Alles, was bis 1552 eingezogen worden war, war für die katholische Kirche verloren. Das bekam sie nicht mehr zurück. Aber galt auch der Umkehrschluss? Die katholische Seite las die Bestimmung so, für sie war 1552 ein Stichdatum. Danach durfte die evangelische Seite keine kirchlichen Besitzungen mehr einziehen. Evangelische Obrigkeiten lehnten diesen Umkehrschluss ab und lösten weitere Klöster auf. Aus dem Ius reformandi, ja, aus dem Wesen der Landeshoheit überhaupt ergebe sich, dass ein protestantischer Landesherr alles beseitigen dürfe, was sich nicht mit dem Geist einer evangelischen Kirchenordnung vertrage. Größer konnte der Gegensatz zwischen beiden Lesarten gar nicht sein – womit jeder windschiefe Schuppen, der von einer Klosteranlage übrig geblieben war, jede sumpfige Wiese, die einmal Mönchen gehört hatte, fortan die größten Verwicklungen auslösen und die Reichsgerichte beschäftigen konnte: Denn es ging ja um nicht weniger als um die Auslegung des Religionsfriedens!
Der Geistliche Vorbehalt
Erbittert stritt man auch über den „Geistlichen Vorbehalt“ von 1555. Er legte fest, dass ein geistlicher Fürst, wenn er zum Protestantismus [<<25] konvertiere, seiner kirchlichen Ämter und Würden verlustig gehe. Der katholische Fürst wurde also durch seine Konversion zum evangelischen Privatmann. In katholischer Auslegung schützte der Geistliche Vorbehalt die damals noch existierenden geistlichen Territorien: also Gebiete, die von einem Fürstbischof oder einem Reichsabt regiert und am Reichstag vertreten wurden. (Im ersteren Fall nennen wir jenen Teil des Bistums, in dem der Fürstbischof nicht nur oberste geistliche Autorität, sondern ferner Landesherr war, das „Hochstift“.) Solche Territorien konnten, wiewohl ja Wahlfürstentümer, dieser Interpretationslinie zufolge niemals in die Hände evangelischer Herrscher geraten.
Hingegen verwiesen die Protestanten des Konfessionellen Zeitalters darauf, dass der Geistliche Vorbehalt dem Domkapitel ja nicht verbiete, jemanden zum Bistumsvorsteher zu wählen, der von vornherein evangelisch, also nicht zum Protestantismus konvertiert war. Und außerdem hätten sie dem Geistlichen Vorbehalt 1555 nicht zugestimmt, eine eigene kleine Präambel zu dieser Passage des Religionsfriedens hält das in der Tat fest. Also gehe diese Bestimmung sie, die Protestanten, gar nichts an. Ein noch heute bekannter, übrigens ziemlich blutiger Kampf um den Geistlichen Vorbehalt war der Kölner Krieg seit 1583. Kurköln blieb katholisch, mit Waffengewalt behauptete sich die katholische Auslegung.
Die Declaratio Ferdinandea
Ähnlich umstritten war die Declaratio Ferdinandea („Erklärung Ferdinands“). Mit ihr wollte der Vertreter des Kaisers am Reichstag von 1555, sein Bruder Ferdinand, die über den Geistlichen Vorbehalt erbosten Protestanten etwas besänftigen. Was beinhaltete seine Deklaration? Landsässiger Adel, Städte und Gemeinden unter der Landesherrschaft eines geistlichen Fürsten, die längst schon protestantisch geworden seien, dürften eben dieses bleiben. Ihnen dürfe der geistliche Fürst nicht, wie seine weltlichen Kollegen, den Glauben vorschreiben.
Warum aber war nun die Declaratio strittig? Sie war nicht Bestandteil des offiziellen Gesetzestextes, wurde deshalb auch nicht dem Reichskammergericht (als legislative Grundlage seiner Rechtsprechung) zur Kenntnis gebracht. Ferdinand schob eben, salopp formuliert, zur Beruhigung der aufgebrachten Protestanten rasch noch einen Zettel nach, dann ging man nach Hause. Die Declaratio spielte rund eine Generation lang in der Reichspolitik so gut wie keine Rolle, geriet fast in Vergessenheit. Erst, als sich die Streitfälle zwischen den [<<26] Konfessionen im letzten Viertel des Jahrhunderts wieder häuften, wurde das Papier von den Protestanten regelrecht wiederentdeckt. Sie warfen gegenreformatorisch aktiven geistlichen Fürsten vor, sehenden Auges dagegen zu verstoßen. Jene bezweifelten die Rechtskraft der Declaratio, jedenfalls über Ferdinands Tod hinaus.
Der Reichsstädteparagraf
Nehmen wir uns nur noch eine letzte der strittigen Klauseln von 1555 vor: den Reichsstädteparagrafen! Die Sonderregelung liest sich ganz modern: In denjenigen reichsstädtischen Kommunen, in denen beide Konfessionen „in gang und gebrauch“ seien, solle das „also bleiben“, sollten Lutheraner und Katholiken weiterhin „fridlich und ruewig bei- und nebenainander wonen“. Was heute nur vernünftig klingt und ganz unproblematisch anmutet, hat damals die größten Verwicklungen ausgelöst, nicht nur, weil das hehre Ideal keinerlei Ausführungsbestimmungen flankierten, die, beispielsweise, die Zuteilung von Kirchenraum oder die konfessionelle Zusammensetzung von Stadtrat wie kommunaler Verwaltung geregelt hätten. Um nur eine für die Väter des Religionsfriedens nicht vorhersehbare Folge zu erwähnen: Wenn der Stadtrat für die einen mit Recht Weihnachtspause einlegte, lebten die anderen schon am 3. Januar des Folgejahres. Denn seit 1582 datierten Katholiken und Protestanten nicht mehr einheitlich, die Katholiken waren den Protestanten um zehn Tage voraus.
Der Reichsstädteparagraf hielt aber nicht nur die bikonfessionellen unter den Reichsstädten in Atem. Im Streit der konfessionsspezifischen Interpretationsschulen wurde alsbald fraglich, ob reichsstädtischen Magistraten überhaupt ein Ius reformandi eigne. Die katholische Auslegungslinie verneinte das, über die Konfession der Reichsstädte entscheide nämlich das katholische Reichsoberhaupt. Das sahen die Reichsstädte selbst und alle Protestanten Deutschlands ganz anders. Jahrzehntelang rang man in Aachen darum, ob diese im Jahr 1555 katholische Kommune Heimstatt auch für Protestanten (oft Glaubensflüchtlinge aus Westeuropa) werden dürfe. Zweimal stellten Truppen benachbarter katholischer Territorien die Vorherrschaft des Katholizismus in Aachen gewaltsam wieder her.
Читать дальше