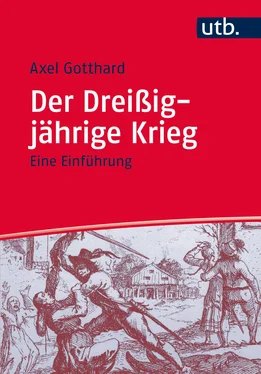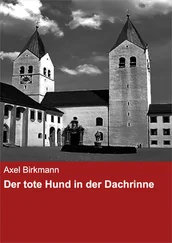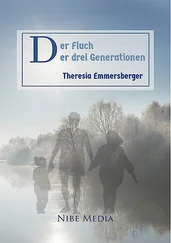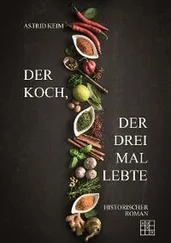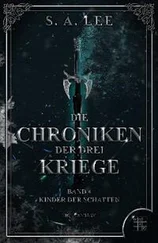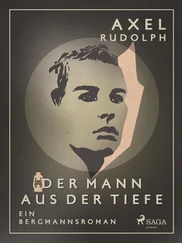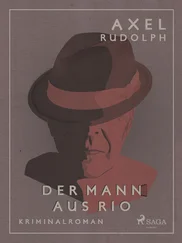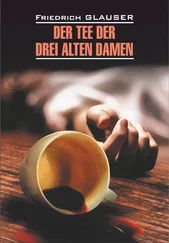Den damaligen Akteuren zu unterstellen, dass sie den Religionsfrieden dabei zynisch missbraucht, dass sie einfach verlogene Schlagworte vor sich hergetragen hätten, wäre unangemessen – nicht, weil Menschen des Konfessionellen Zeitalters edler und wahrhaftiger gewesen wären als der kapitalistische Homo oeconomicus (wer wollte das ermessen!), aber weil bei ihnen Recht, Politik und Theologie – in modernen Augen verschiedene Sachgebiete mit ihren je eigenen Sachlogiken – eben völlig ineinander verschränkt waren. Diese Menschen fochten für viel mehr als ‚nur‘ für Rechtspositionen, doch spricht nichts dafür, dass sie nicht davon überzeugt gewesen wären, dass das Recht auf ihrer Seite stand. Sie kämpften für ihr gutes Recht, von dem sie schon deswegen nicht abrücken konnten, weil es auf ihre Wahrheit und ihre Gerechtigkeit verwies. Weil man mit jeder Nachgiebigkeit auf dem juristischen Kampfplatz Seelenheil verspielte, konnte man nicht „durch die finger sehen“, wie das die Jahrzehnte um 1600 formulierten, konnte man, modern gesagt, nicht einfach bisweilen „alle Fünf grade sein lassen“, musste man vielmehr unerbittlich auf seinen Paragrafen herumreiten. Eben deshalb wirkte die „Verrechtlichung“ eines zentralen Problems der Reichspolitik in diesem Fall nicht befriedend.
Die 1555 ausgeklammerte Wahrheitsfrage drängte ein halbes Jahrhundert später machtvoll in die gelehrten und die politischen Diskurse zurück. Es wurde immer schwieriger, einen Kernbereich reichspolitischen Aushandelns und reichspolitischen Krisenmanagements gegen das anbrandende Wahrheitsproblem, die Konkurrenz eines doppelten, je exklusiven Wahrheitsmonopols abzuschirmen. Die [<<58] Verrechtlichung des Konfessionsdissenses mündete in die Abdankung der Politik zugunsten der Rechthaberei.
Setzt interkonfessioneller Frieden „Aufklärung“ und ein „liberales“ Menschenbild voraus?
Ob man wirklich aus der Geschichte – oder doch nur aus eigenen Fehlern lernen kann? Lernen wir aus der Geschichte, dass haltbare interkonfessionelle Friedensschlüsse nur zwischen Bekenntnisgemeinschaften möglich sind, die ihre Phase von „Aufklärung“ durchlaufen haben? Gar nur zwischen Gesellschaften mit individualistischer, liberal imprägnierter Anthropologie, die – mit vielen anderen Lebensbereichen – auch die Weltanschauung gleichsam privatisiert (oder doch, wie hier in Deutschland, jedenfalls teilprivatisiert) haben? Wissenschaftlich stringent beantworten kann Geschichtsschreibung solche Fragen nicht, sie kann sie nur aufwerfen.
1.5 Die böhmischen Anlässe des Dreißigjährigen Krieges
1.5.1 Rückblicke: lange Tradition konfessioneller Heterogenität und ständischer Aufmüpfigkeit
Dass die Funken, die seit 1620 Teile Europas in Brand setzten, aus Böhmen herüberwehten, ist ganz zufällig – wir sahen, dass das Reich ein Pulverfass war, das sich schon 1610 beinahe an niederrheinischem Konfliktpotenzial entzündet hätte. Dass die Funken, die seit 1620 Teile Europas in Brand setzten, aus Böhmen herüberwehten, ist höchst bezeichnend – auch so kann man es sehen: eine Frage der Perspektive.
Warum könnte man denn Böhmen gewissermaßen für seine Rolle prädisponiert sehen? Nun, zwei große politische Themen der Jahrzehnte um 1600, wohl die damals zentralen, waren erstens der Widerstreit der Konfessionen, zweitens der Widerstreit zwischen erstarkender Zentralgewalt im Vorhof des „Absolutismus“ und ständischen Partizipationsansprüchen. (Der Schulbüchern geläufige Terminus „Absolutismus“ gefällt vielen Wissenschaftlern nicht mehr als Epochenbegriff, manche verwenden den Terminus überhaupt nicht mehr – kein Thema für dieses Büchlein, das es, manchmal in Anführungszeichen, beim „Absolutismus“ belässt, schon weil sich bislang keine griffige Alternative etabliert hat.) Böhmen hatte damals eine schon lange Tradition weltanschaulicher Heterogenität; und es hatte ungewöhnlich [<<59] selbstbewusste Stände. Die beiden großen Antagonismen der Zeit waren in Böhmen schon seit Generationen virulent, wurden hier auf engem Raum ausgefochten. Zeittypisch waren der Kampf um Seelen und das Ringen um die Macht ineinander verknäuelt. Dennoch: Trennen wir beide Aspekte einmal der Übersichtlichkeit halber voneinander!
Warum die böhmischen Stände traditionell stark sind
Warum waren denn die böhmischen Stände besonders stark und selbstbewusst? Zum einen waren die Stände überall in Mittelosteuropa stark. Es hat auch ökonomische Gründe. Anders als die „Grundherren“ Westeuropas, die fast alles Land an weitgehend selbstständig arbeitende Bauern verliehen, bewirtschafteten die ostmitteleuropäischen Magnaten mithilfe der „niedergelegten“, faktisch zu Lohnarbeitern heruntergedrückten einstigen Bauern riesige Ländereien. Sie agierten dabei sprichwörtlich „nach Gutsherrenart“, ließen sich von der schwachen Zentrale nicht dreinreden. Bei den Ständen Habsburgs kam ein Zweites hinzu: Die Habsburgerlande grenzten ans osmanische Riesenreich, die „Türkengrenze“ lief mitten durch Ungarn, Böhmen war nicht weitab. Die Habsburger brauchten die Mitwirkung und Zahlungsbereitschaft ihrer Stände, waren gleichsam erpressbar. Die Stände hat auch dieser enorme Geldbedarf der Zentrale stark gemacht.
Die Steuerverwaltung war ständisch, wie vielerorts; auch die Aufbringung und Verwendung der indirekten Steuern, andernorts Ansatzpunkt frühabsolutistischer Vorstöße der Landesherren, war unter den Habsburgern Ständesache. Nicht einmal Kriegsherren waren die Habsburger unumschränkt, man war dort als Militär nicht habsburgischer, sondern „der Landschafft Kriegs officir“, der ständische Einfluss auf die „Landesdefension“ war groß. Sogar außenpolitisch wurden die Landstände bisweilen aktiv – so verhandelten sie beispielsweise in den Anfangsjahren der Union (wenn auch ohne bleibende Resultate) mit Vertretern dieses Konfessionsbündnisses über Kooperationsmöglichkeiten.
Kurz, die habsburgischen (auch, und zumal die böhmischen) Landstände agierten, als seien sie Reichsstände, eigene Herrschaftsträger. War es nicht ein signifikanter Unterschied, dass sich die Reichsstände zwar einem Habsburger unterstellten, den aber als Reichsoberhaupt frei und zu ihren – in der Wahlkapitulation festgehaltenen – Bedingungen wählten, während Böhmen Erbbesitz der Dynastie war? Sogar dieses Erbrecht der Habsburger wurde immer wieder angezweifelt [<<60] oder relativiert. So führte man bei jedem Herrscherwechsel Huldigungsverhandlungen – man stellte also seine Bedingungen für die ‚Unterwerfung‘, eben die Huldigung. Oder man behauptete ganz offen, die böhmische Krone sei tatsächlich eine Wahlkrone; Matthias (Böhmenkönig seit 1611) musste ein Dokument unterzeichnen, das seine Nachfolge als „freie Wahl“ der Landstände deklariert. Es gab unter den Landständen in dieser Frage drei Positionen: ein kleines Häuflein, das der Erbkrone das Wort redete; gemäßigte Anhänger der Wahlkrone; und radikalere. Letztere behaupteten, „Wahl“ meine nicht nur Auswahl innerhalb der angestammten Dynastie, sondern beinhalte auch die Möglichkeit des Dynastiewechsels.
Hinzu kommt, dass die im Konfessionellen Zeitalter so zentrale Kirchengewalt traditionell eher ständisch als landesherrlich war. Ungefähr vier Fünftel der von den katholischen Habsburgern regierten Adeligen waren im 16. Jahrhundert evangelisch geworden, sie nötigten diese Option auch ihren Hintersassen auf; was die Regierungen durch weitreichende Konzessionen absegneten. Faktisch besaß also in den Habsburgerlanden nicht die Landesherrschaft, sondern der landständische Adel das Ius reformandi.
Warum Böhmen schon lange nicht mehr geschlossen katholisch ist
Jetzt sind wir fast unvermerkt doch schon beim zweiten Aspekt angekommen: der konfessionellen Ausrichtung. Die meisten böhmischen Adeligen waren keine Mitglieder der römischen Kirche. Welcher Konfession gehörten sie denn an? Nun, zum Teil tendierten sie zu den neueren europäischen Reformationsströmungen (wie dem Calvinismus oder, häufiger, dem Luthertum); zum Teil standen sie in der älteren, einheimischen hussitischen Tradition.
Читать дальше