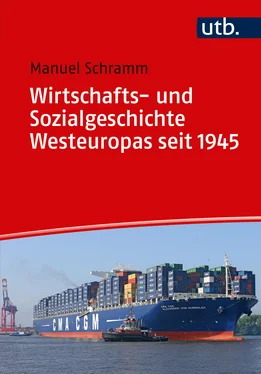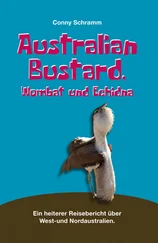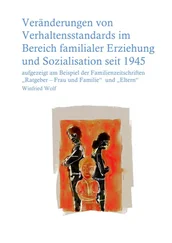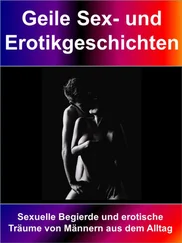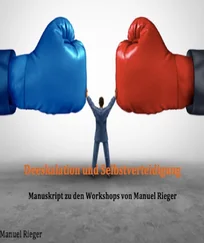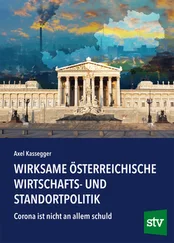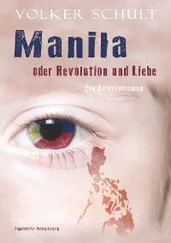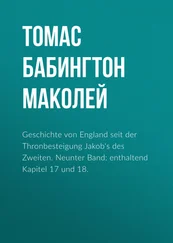Abb 2Der Kollaboration beschuldigte Frauen in Paris, Sommer 1944 (Quelle: Bundesarchiv 146–1975–041–10).
Die „wilden“ Säuberungen waren zweifellos mit dem Rechtsstaat nicht vereinbar. Ob dabei die wirklichen Schuldigen getroffen oder nur offene Rechnungen beglichen wurden, ist nicht sicher. Letztlich war diese Form der Säuberung aber in erster Linie ein Übergangsphänomen, das in die Zwischenzeit zwischen dem Ende der deutschen Besatzungsherrschaft oder faschistischen Herrschaft und dem staatlichen Neubeginn fiel. Zudem fanden viele dieser Säuberungen im Zusammenhang mit Kampfhandlungen statt. Nach der Übernahme der Verwaltung durch die Alliierten fanden diese Säuberungen meist ein rasches Ende. Allein in Italien setzten sie sich noch bis Ende 1945 fort.
1.2.2Die administrativen Säuberungen
Die administrativen Säuberungen waren das bevorzugte Mittel der Alliierten in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Meist wurden generell alle wichtigen Funktionsträger des alten Regimes entlassen oder gleich interniert. Das führte natürlich zu Massenverhaftungen mit allen damit verbundenen Problemen. In Frankreich wurden unmittelbar nach der Befreiung ca. 126.000 Personen interniert, in Belgien 70.000, in den Niederlanden 120.000 und in Deutschland allein von den Westalliierten ca. 200.000. Die meisten wurden allerdings 1945 oder 1946 wieder freigelassen, wie z.B. in Belgien, wo die Zahl der Internierten im Frühjahr 1945 von 70.000 auf 20.000 sank, dann aber wieder auf 40.000 anstieg, da viele belastete Personen nach Belgien zurückkehrten. In Deutschland waren Ende 1945 noch schätzungsweise 100.000 Menschen interniert.
Die Internierungen waren ungerecht, aber effektiv; ungerecht, da sie, anders als Gerichtsverfahren, nicht auf der individuellen Schuld der Internierten beruhten; effektiv, da sie gleichzeitig die Funktionsträger der alten Regime zumindest so lange von den Schaltzentralen der Macht fernhielten, bis sich die Verhältnisse einigermaßen stabilisiert hatten. Die Abkehr von dieser Art der Säuberung erfolgte nicht erst unter dem Eindruck des Kalten Krieges, sondern schon recht bald. Der Grund war eher innenpolitischer Natur: Die Regierungen wollten verhindern, dass sich eine quasi permanente Kaste von Unzufriedenen bildete, welche eine Gefahr für die Demokratie hätten bilden können. In der Tat bildeten sich in mehreren Ländern Parteien, die den Protest gegen die Entnazifizierung in die Parlamente trugen: in Belgien die flämische „Volksunie“, in Italien die neofaschistische „Jedermanns-Front“ und später der MSI (Movimento Sociale Italiano), in Deutschland der „Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten“. Sie hatten in Wahlen zwar nur begrenzten Erfolg (selten mehr als 5 Prozent), aber es genügte, um zu signalisieren, dass es ein gefährliches Potential von Unzufriedenen gab.
Aber nicht nur die Internierten mussten sich der bürokratischen Prozedur der administrativen Säuberung stellen. In den westlichen Besatzungszonen Deutschlands wurden Millionen von Menschen auf ihre Einstellung zu und ihre Tätigkeit im NS-Regime überprüft. Die US-amerikanischen Besatzungsbehörden ließen 13,2 Millionen Meldebögen ausfüllen, von denen allerdings nur 945.000 überhaupt weiter verfolgt wurden. Auch in der britischen Besatzungszone wurden mehr als 2 Millionen Menschen überprüft. Im März 1946 führte zu diesem Zweck zunächst die US-amerikanische Militäradministration das Spruchkammerverfahren ein. Die mit unbelasteten Juristen und Laienrichtern besetzten Spruchkammern hatten die Überprüften in fünf Kategorien einzuteilen von „Hauptschuldige“ bis „Entlastete“. Die Kammern waren aber von der Vielzahl der Verfahren überfordert, und so genügte häufig schon ein Leumundszeugnis („Persilschein“), um als „Mitläufer“ oder „Entlasteter“ weitgehend straffrei auszugehen, was den Spruchkammern den Ruf der „Mitläuferfabriken“ (Lutz Niethammer) einbrachte. In der Tat wurden in der US-Zone schließlich 77 Prozent der Beschuldigten als Mitläufer eingestuft (und 3 Prozent als Entlastete). In der britischen Zone wurden sogar mehr als 80 Prozent der Fälle als vollständig entlastet eingestuft.
1.2.3Die justiziellen Säuberungen
Nach der Kapitulation Deutschlands nahmen die Alliierten die Bestrafung der Hauptkriegsverbrecher in die eigenen Hände. So kam es bereits im Oktober 1945 vor den berühmten Nürnberger Prozessen in der britischen Besatzungszone zu den Lüneburger Prozessen (oder Bergen-Belsen-Prozessen) gegen KZ-Wachmannschaften. Im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess 1945/46 wurden 12 von 24 Angeklagten zum Tode verurteilt, u.a. wegen des neu geschaffenen Tatbestands „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“. In den Folgeprozessen von 1946 bis 1949 wurde gegen weitere 177 Angeklagte verhandelt und dabei 25 Todesurteile ausgesprochen. Der Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess war trotz gewisser formaler Mängel ein weitgehend faires Verfahren und gilt heute als Meilenstein der internationalen Strafgerichtsbarkeit.
Wie aus den geringen Fallzahlen ersichtlich, lag die Hauptverantwortung für die justizielle Aufarbeitung jedoch nicht bei den Alliierten, sondern bei den jeweiligen Einzelstaaten. Wieder waren es Hunderttausende, gegen die Verfahren oder Voruntersuchungen eingeleitet wurden: in Österreich 137.000, in Frankreich 350.000, in Dänemark 40.000, in Norwegen 93.000 und in Belgien ebenfalls 350.000. Weit weniger beeindruckend waren die Zahlen in Deutschland, wo bis 1949 nur ca. 13.000 Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden. Bis Ende der fünfziger Jahre verfolgte die westdeutsche Justiz nur Vergehen, die in Deutschland begangen worden waren. Das änderte sich erst mit dem Ulmer Prozess gegen die „Einsatzgruppe Tilsit“ 1958.
Aus verschiedenen Gründen gab es erhebliche Differenzen beim Vorgehen gegen Kollaborateure, NS- und Kriegsverbrecher: Das NS-Besatzungsregime war von Land zu Land unterschiedlich repressiv gewesen, der Grad der ideologischen Durchdringung war unterschiedlich, nationale Rechtstraditionen und die politische Situation nach dem Krieg spielten ebenfalls eine Rolle. Am gründlichsten ging man vielleicht in Norwegen vor, wo schon die Mitgliedschaft in einer NS-Organisation als Straftatbestand gewertet wurde. Von den 93.000 Beschuldigten, gegen die Verfahren eingeleitet wurden, wurden über 20.000 verurteilt; weitere 28.000 akzeptierten eine Strafe ohne Prozess. Die Strafen fielen allerdings meist gering aus, nur in 25 Fällen wurde die Todesstrafe verhängt.
Eine geringe Rolle spielte dagegen die justizielle Säuberung in Italien. Zwar wurden nach Kriegsende außerordentliche Schwurgerichte eingesetzt, und ca. 20.000 bis 30.000 Verdächtige angeklagt. Bereits im Sommer 1946 kam es jedoch zu einer großzügigen Amnestieregelung, so dass viele Faschisten, die die „wilden“ Säuberungen überlebt hatten, ohne Strafe oder mit geringen Strafen davonkamen. Darunter waren nicht nur kleine Fische, sondern auch prominente Personen wie Rodolfo Graziani, der frühere Oberbefehlshaber der faschistischen Truppen der Republik von Salò, der nicht mehr als drei Monate im Gefängnis verbringen musste.
Nicht nur in Italien, sondern auch in anderen Ländern kam es angesichts der Vielzahl der Fälle von „kleinen“ Nazis und der Überforderung des Justiz- und Verwaltungsapparats immer wieder zu Forderungen nach Amnestien. In der Tat wurden in vielen Ländern mehr oder weniger weitreichende Amnestiegesetze beschlossen: in Italien und den Niederlanden bereits 1946, in Österreich und Norwegen und wiederum in Italien 1948, in Deutschland 1949 und 1951, in Frankreich 1951 und 1953. Neben der wohl unvermeidlichen Amnestierung der „kleinen“ Nazis und Faschisten profitierten von der „Rehabilitierungswut“ (Bauerkämper) auch „große“ oder zumindest „mittelgroße“ Belastete, die zum Teil sogar wieder in Führungspositionen aufstiegen. So hatten sowohl der Pariser Polizeichef Maurice Papon, der 1961 eine Demonstration von Algeriern brutal niederschlagen ließ, als auch der deutsche Vertriebenenminister Theodor Oberländer, als auch der Fraktionsvorsitzende der niederländischen Christdemokraten Willem Aantjes eine NS-Vergangenheit, über die sie später stolperten.
Читать дальше