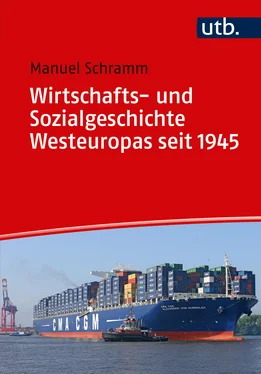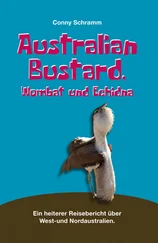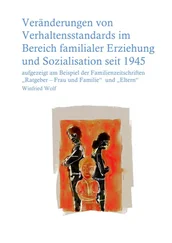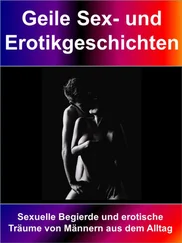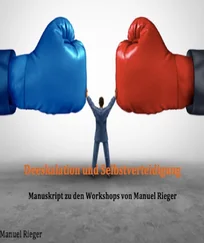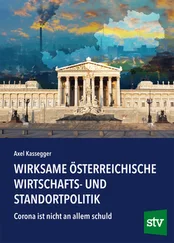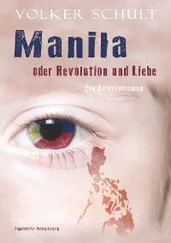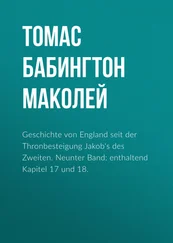Heftige Streik- und Protestwellen erschütterten auch und insbesondere Frankreich. Schon 1946 kam es immer wieder zu wilden Streiks, die weder von der in der Regierung vertretenen kommunistischen Partei noch der ihr nahestehenden Gewerkschaft CGT gebilligt wurden. Als jedoch im April 1947 in der CGT-Hochburg Renault-Billancourt ein Streik ausbrach, sah sich die Gewerkschaft nach kurzem Zögern gezwungen, sich dem Streik anzuschließen, wollte sie nicht ihre treuesten Unterstützer verprellen. Das zwang wiederum die kommunistische Partei zu einer Neuorientierung in der Sozial- und Wirtschaftspolitik und führte zu ihrem Ausscheiden aus der Regierung im Mai 1947. Damit war der Höhepunkt der Streikaktivitäten noch nicht erreicht. Im November gab es bei einer Protestdemonstration in Marseille gegen die Erhöhung der Straßenbahnfahrpreise einen Toten. Dem daraufhin ausgerufenen lokalen Generalstreik schlossen sich rasch die nordfranzösischen Bergleute an, und kurze Zeit später waren 2 Millionen Arbeiter im Ausstand. Die Regierung reagierte mit Antistreikgesetzen und dem Einsatz von Polizei und Armee, nicht aber mit Zugeständnissen. Ähnliches spielte sich im Oktober und November 1948 ab, als wiederum die Bergleute in den Streik traten, in dessen Verlauf 1041 Streikende verhaftet und 479 Polizisten verletzt wurden.
Die Auseinandersetzungen in Italien waren kaum weniger heftig. Im Juli 1946 wurden in Venedig Lebensmittelgeschäfte geplündert und in Turin ein Generalstreik ausgerufen. Im Oktober 1946 besetzten Demonstranten die Residenz des Ministerpräsidenten in Rom. In den heftigen Auseinandersetzungen mit der Polizei gab es zwei Tote und über 150 Verletzte. Gleichzeitig protestierten in den ländlichen Regionen bis zum Sommer 1947 immer wieder die Landarbeiter und Halbpächter. Zu landesweiten Streiks und Fabrikbesetzungen der kommunistischen Arbeiter kam es nach einem Attentat auf den kommunistischen Parteichef Palmiro Togliatti am 14. Juli 1948. In Genua übernahmen die Streikführer sogar kurzzeitig die Kontrolle über die Stadt, und eine Revolution schien im Bereich des Möglichen. Erst im Lauf des Jahres 1949 verbesserte sich die ökonomische Situation spürbar, und die sozialen Auseinandersetzungen ebbten ab.
Diese Streiks und Proteste weisen schon darauf hin, dass die Rationen- und Schwarzmarkt-Gesellschaften keineswegs durch die Not zusammengeschweißt wurden. Richtig ist zwar, dass traditionelle soziale Unterschiede teilweise an Bedeutung verloren, ja bisweilen sogar umgekehrt wurden. In der Notzeit war beispielsweise die Landbevölkerung meist besser versorgt als die normalerweise besser situierten Stadtbewohner. Ansonsten dominierte aber eine negative „Vergleichsmentalität“ (Rainer Gries), in der jeder neidisch auf den oder die andere blickte, die mehr hatte als man selbst. Eine gewisse Nivellierung fand dadurch statt, dass ansonsten gut verdienende städtische Angestellte oder Beamte nicht besser-, sondern eher schlechtergestellt waren als Arbeiter oder Bauern. Dort, wo die Rationierung gut funktionierte wie in Großbritannien, konnte sie somit durchaus positive Folgen zeitigen. Die britischen Arbeiter waren in der Zeit der Rationierung besser ernährt als vorher, und nicht zuletzt deswegen war das Ende der Rationierung in Großbritannien durchaus umstritten. In den meisten anderen Ländern jedoch erzeugte die Rationierung neue Formen der sozialen Ungleichheit durch den Aufstieg der Kriegsgewinnler, Spekulanten und „Schieber“, deren schneller Reichtum eher auf Beziehungen als auf Leistung zurückzuführen war und der dementsprechend wenig Akzeptanz gewinnen konnte.
Literatur
Corni, Gustavo/Gies, Horst: Brot, Butter, Kanonen. Die Ernährungswirtschaft in Deutschland unter der Diktatur Hitlers, Berlin 1997
Duchen, Claire: Women’s Rights and Women’s Lives in France, 1944–1968, London 1994
Gildea, Robert/Wieviorka, Olivier/Warring, Anette (Hg.): Surviving Hitler and Mussolini. Daily Life in Occupied Europe, Oxford 2006
Gries, Rainer: Die Rationen-Gesellschaft. Versorgungskampf und Vergleichsmentalität. Leipzig, München und Köln nach dem Kriege, Münster 1991
Helstosky, Carol: Garlic and Oil. Food and Politics in Italy, Oxford 2004
Shorter, Edward/Tilly, Charles: Strikes in France, 1830–1968, London 1974
Trentmann, Frank/Just, Flemming (Hg.): Food and Conflict in Europe in the Age of two World Wars, Basingstoke 2006
Zierenberg, Malte: Stadt der Schieber. Der Berliner Schwarzmarkt 1939–1950, Göttingen 2008
Zweiniger-Bargielowska, Ina: Austerity in Britain. Rationing, Controls, and Consumption, 1939–1955, Oxford 2000
1.2Vergangenheitspolitik
Eine der wichtigsten Aufgaben für die westeuropäischen Gesellschaften der Nachkriegszeit war der richtige Umgang mit der Vergangenheit, also die „Vergangenheitspolitik“ (Norbert Frei). In erster Linie ging es darum, die postfaschistischen Demokratien zu stabilisieren, in zweiter Linie darum, dem berechtigten Verlangen der Opfer nach Gerechtigkeit Genüge zu tun. Ein radikaler Bruch mit der Vergangenheit wurde aber durch mehrere Umstände erschwert, die freilich von Land zu Land unterschiedlich ausfielen: Zum einen wogen die Probleme der Gegenwart (vor allem der Versorgung) für viele Menschen schwerer als diejenigen der Vergangenheit, und die Säuberungen drohten an Akzeptanz zu verlieren, wenn sie durch massenhafte Entlassungen oder Internierungen die Verwaltung schwächten und die Versorgungslage verschärften. Zum Zweiten war es in vielen Ländern schlicht schwierig, gleichzeitig erfahrene und unbelastete Angehörige von Verwaltung, Justiz, Polizei oder Militär in ausreichender Zahl zu finden, so dass eine Amnestie der geringer Belasteten in manchen Ländern (wie Deutschland oder Italien) unausweichlich war, wollte man sie nicht dauerhaft unter ausländische Verwaltung stellen.
Hinzu kam, dass sich der Rechtsstaat als Mittel zur Auseinandersetzung mit den faschistischen oder nationalsozialistischen Eliten und ihren Helfershelfern als wenig geeignet erwies. In fast allen Ländern wurden mehr oder minder geglückte juristische Hilfskonstruktionen (z. B. „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, Sondergerichte) angewendet, um die Täter überhaupt vor Gericht stellen und bestrafen zu können. Das brachte den Prozessen von Seiten der Angeklagten wie der politischen Rechten allgemein den Vorwurf der „Siegerjustiz“ ein. Bis heute wird bemängelt, dass die juristische Auseinandersetzung mit den untergegangenen Regimen nach dem Krieg zentrale rechtsstaatliche Grundsätze verletzt habe, so das Rückwirkungsverbot, nach dem geltendes Recht nicht rückwirkend angewendet werden darf, oder die mangelnde Trennung zwischen Anklägern und Richtern. Es wird bei dieser Kritik jedoch gern übersehen, dass die faschistischen und nationalsozialistischen Regime in Europa nicht legal an die Macht gelangt waren, auch dort nicht, wo sie versuchten, den Schein der Legalität zu wahren wie in Deutschland, Italien oder Frankreich. Daher greift es zu kurz, sich auf einen angeblichen „Befehlsnotstand“ zu berufen, da die Befehle an sich schon keine ausreichende Rechtsgrundlage besaßen.
1.2.1Die „wilden“ Säuberungen
Generell lässt sich zwischen den „wilden“, den administrativen und den juristischen Säuberungen unterscheiden. Die „wilden“ Säuberungen fanden im Wesentlichen in zwei Wellen statt, nämlich direkt nach dem Abzug der deutschen Truppen in vielen Gebieten im Herbst 1944 und nach der formellen Kapitulation der Wehrmacht im Frühjahr 1945. Sie forderten zahlreiche Todesopfer, in Frankreich ca. 10.000, in Italien 10.000 bis 12.000, in den Niederlanden ca. 100. Neben Hinrichtungen ohne Gerichtsverfahren oder mittels Schnellverfahren kam es zu spontanen Verwüstungen von NS-Zentralen, Inhaftierungen (in Dänemark allein ca. 20.000) und Gewalt gegen wirkliche oder vermeintliche Kollaborateure. Häufig wurden gerade Frauen Opfer von ritueller Gewalt in der Form des öffentlichen Scherens. Allein in Frankreich wurden ca. 20.000 der Kollaboration beschuldigten Frauen die Haare geschoren.
Читать дальше