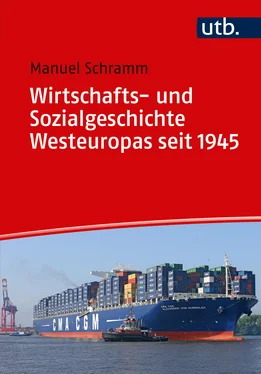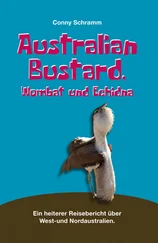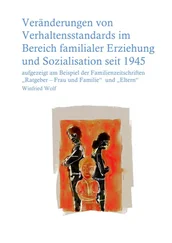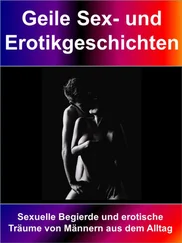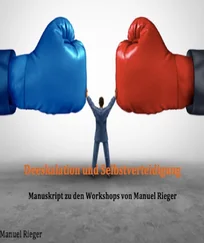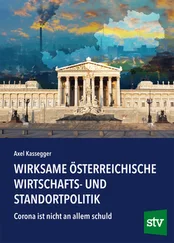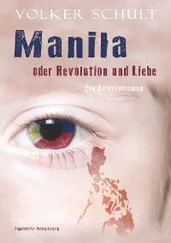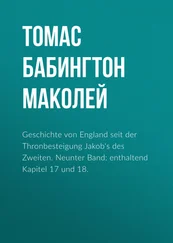Das Rationierungsregime herrschte von Land zu Land unterschiedlich lange. Zudem umfasste es häufig nur einen Teil der Güter des täglichen Bedarfs. Dennoch ist es hilfreich, sich vor Augen zu halten, wie lange die Bevölkerung in manchen Ländern mit Einschränkungen der einen oder anderen Art leben musste. In der noch jungen Bundesrepublik Deutschland beispielsweise wurde das bevorstehende Ende der Rationierung Anfang 1950 in der Presse als Ende einer über dreizehnjährigen Periode der Einschränkungen und Entbehrungen gefeiert. Tatsächlich waren es fast vierzehneinhalb Jahre, da schon im Herbst 1935 Kundenlisten für Butter und Schmalz eingeführt worden waren. Das Ende der Rationierung kam hier mit dem 1. April 1950, als die Rationierung für Zucker aufgehoben wurde.
Auch andere Länder hatten lange Perioden der Einschränkungen hinter sich, als die Rationierung schrittweise seit Ende der vierziger Jahre aufgehoben wurde. Zwar dauerte es in Westeuropa nirgendwo so lange wie in der DDR, wo das definitive Ende erst 1958 kam und kurz darauf sogar wieder Kundenlisten für Butter eingeführt werden mussten. Doch auch in Westeuropa zog sich die Periode der Rationierung in einzelnen Ländern bis in die fünfziger Jahre hinein, so in den Niederlanden bis Januar 1952 (für Kaffee) oder in Großbritannien bis Juli 1954 (für Fleisch, Schinken, Speck). Selbst in Italien, wo die Rationierung bereits 1948 endete, hatte die Bevölkerung bereits seit 1937 (mit der Einführung des dunklen „Einheitsbrotes“) unter Einschränkungen leiden müssen. Die Zeit der Rationierung war nicht nur eine Episode, sondern dauerte ein gutes Jahrzehnt und bildete somit ein prägendes Erlebnis für viele Menschen, die sie miterleben mussten.
1.1.1Alternative Beschaffungsformen
Da die Rationen in den meisten Ländern nicht ausreichten, sahen sich große Teile der Bevölkerung, vor allem in den Städten, gezwungen, nach alternativen legalen, halblegalen oder illegalen Mitteln der Nahrungs- und Brennstoffbeschaffung zu suchen. Dazu gehörten Schlangestehen, Hamsterfahrten auf das Land, Pakete von Verwandten oder Bekannten und nicht zuletzt der Schwarzmarkt. Welches dieser Mittel effektiver war, unterschied sich von Fall zu Fall. Der Anteil der Nahrungsmittel, die über das offizielle Rationierungssystem zu erhalten waren, variierte von Land zu Land und über die Zeit erheblich. In Rom verschwanden im Juli 1944 ca. drei Viertel der Nahrungsmittel auf dem Schwarzmarkt. In Großbritannien entfielen 1947/48 ca. die Hälfte der Ausgaben auf rationierte Nahrungsmittel. Und in Frankreich konnten 1945 zwei Drittel der nichtbäuerlichen Bevölkerung nur zwischen 50 und 75 Prozent ihrer Nahrungsmittelbedürfnisse über das Rationierungssystem abdecken. Besonders schwierig war die Lage in Paris, wo die Einwohner im Januar 1945 für 53 von 62 Mahlzeiten auf den Schwarzmarkt angewiesen waren. Wie auch immer man es berechnet: Der Schwarzmarkt oder andere Beschaffungskanäle mussten einen großen Beitrag zur Versorgung leisten, sonst drohte der Hunger.
Insofern ist es nicht verwunderlich, dass die Nahrungsmittelbeschaffung bei vielen Menschen eine derart wichtige Stellung einnahm, dass an andere Dinge kaum zu denken war. „Nicht Parteien oder Gewerkschaften bestimmen unser Leben“, schrieb die Kölnische Rundschau im August 1947, „nicht die junge demokratische Regierung oder die Besatzungsmacht, sondern einfach der Hunger, nichts als der Hunger“. 1Ihm zu entkommen, war in den meisten Fällen möglich, aber zeitaufwendig.
Neben dem offensichtlichen Zeitaufwand bargen die alternativen Versorgungswege auch gesellschaftlichen Sprengstoff. Warteschlangen konnten in Protestdemonstrationen, ja sogar Plünderungen münden wie in Montpellier im Dezember 1944, als aufgebrachte Hausfrauen wie bei den Hungerprotesten des 18. und frühen 19. Jahrhunderts Geschäfte plünderten. Hamsterfahrten konnten die Gegensätze zwischen Stadt und Land verschärfen. Andere Praktiken, legal oder nicht, waren die Ausweitung der Selbstversorgung und die Beschaffung von Brennmaterial. Die Bäume des Berliner Tiergartens wurden abgeholzt und das Land unter den Pflug genommen. Erst 1949 begann die Wiederaufforstung des beliebten Parks. Der Kölner Kardinal Frings gewann dauernde Popularität, als er Silvester 1946 indirekt das (weitverbreitete) Stehlen von Kohle oder anderem Brennmaterial legitimierte („Wir leben in Zeiten, da in der Not auch der Einzelne das wird nehmen dürfen, was er zur Erhaltung seines Lebens und seiner Gesundheit notwendig hat, wenn er es auf andere Weise… nicht erlangen kann.“).

Abb 1Der Berliner Tiergarten als landwirtschaftliche Nutzfläche, Juli 1946 (Quelle: Bundesarchiv 183-M1015–314).
Am wichtigsten war vielleicht der Schwarzmarkt, der überall auftrat, wo es Rationierung gab, aber dennoch von Land zu Land und teilweise von Ort zu Ort unterschiedliche Ausmaße und Formen annahm. Dort, wo die Rationierung im Allgemeinen gut funktionierte und die Rationen ein erträgliches Maß behielten, hielt sich auch der Schwarzmarkt in Grenzen, nämlich in Dänemark (wo die Schwarzmarktpreise stabil blieben) und in Großbritannien, wo zudem effektive Kontrollmechanismen installiert wurden. Anderswo, vor allem in Italien, nahm der Schwarzmarkt solche Ausmaße an, dass es wahrscheinlich zutreffender wäre, von einer „Schwarzmarkt-Gesellschaft“ als von einer „Rationen-Gesellschaft“ zu sprechen. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand. Das Rationierungssystem brach 1944 nach dem Einmarsch der Alliierten zunächst vollkommen zusammen, und noch im Juli 1947 waren die Rationen in Rom so niedrig, dass die Normalverbraucher nicht einmal auf 2000 Kalorien am Tag kamen. Hinzu kam, dass der Schwarzmarkt von den Behörden als notwendiges Übel oftmals toleriert wurde. Anders in Frankreich, wo die Behörden im Rahmen ihrer Möglichkeiten versuchten, gegen den illegalen Handel vorzugehen. Jedoch erwiesen sich Praktiken der Unterschlagung, die während der Besetzung Ausdruck nationalen Widerstands gegen die deutschen Besatzer waren, als zählebig.
Der Schwarzmarkt war bei der Not leidenden Bevölkerung nicht besonders beliebt. Die Preise waren häufig exorbitant, das Risiko, von den Behörden entdeckt und bestraft zu werden, immer vorhanden. Daher war der Schwarzmarkt auch weniger eine Einübung in die Marktwirtschaft als vielmehr ein negatives Zerrbild derselben. Er begünstigte vor allem eine kleine Schicht von Menschen, die, über welche Kanäle auch immer, Zugang zu stark nachgefragten Waren hatten, und produzierte somit eine kleine Schicht von Profiteuren, die ihren plötzlichen Reichtum ungeniert zur Schau stellten und somit die sozialen Spannungen zusätzlich anheizten.
1.1.2Gesellschaftliche und politische Implikationen
Die Rationen- und Schwarzmarkt-Gesellschaft führte somit keineswegs zu einer nivellierten Notgemeinschaft, sondern zu zusätzlichen sozialen Spannungen, die sich in erster Linie in Form von Streiks und Protesten artikulierten, mittelbar aber auch für das Schicksal von Regierungen verantwortlich waren (→ Kap. 1.4). In Großbritannien nahmen die Proteste noch relativ milde Formen an. So war ein Hafenarbeiterstreik im Oktober 1945 sehr unpopulär, weil er die ohnehin angespannte Versorgungslage zu verschlechtern drohte. Proteste wurden in der Folgezeit von Hausfrauenorganisationen artikuliert, z. B. gegen die Einführung der Brotrationierung im Sommer 1946.
Schwieriger war die Lage auf dem Kontinent. Hier war es besonders die städtische Bevölkerung, die unter den Versorgungsschwierigkeiten zu leiden hatte. Die Löhne hielten meist nicht mit den steigenden Schwarzmarktpreisen mit, was immer wieder für Empörung sorgte. Zudem war mit zunehmendem zeitlichem Abstand der Krieg immer weniger als Erklärung für die Versorgungsschwierigkeiten akzeptabel. Kritisch waren insbesondere Herbst und Winter eines jeden Jahres. In Köln kam es im Januar 1948 zu einem Generalstreik, an dem sich 120.000 Beschäftigte beteiligten. Die schwersten Krawalle in den westlichen Besatzungszonen fanden jedoch nach der Währungsreform vom Juni 1948 statt, nämlich die „Stuttgarter Vorfälle“ vom 28. Oktober 1948, bei denen nach einer Demonstration gegen die Preissteigerungen infolge der Währungsreform Schaufensterscheiben eingeschlagen und Autos demoliert wurden. Die Gewerkschaften riefen in der Bizone für den 12. November einen Generalstreik aus, an dem sich nach Angaben der Veranstalter über 9 Millionen Menschen beteiligten. Eine Antwort darauf war das bereits im Sommer 1948 angelaufene „Jedermann-Programm“, das mit staatlicher Unterstützung preiswerte Konsumgüter für den Massenmarkt bereitstellen sollte.
Читать дальше