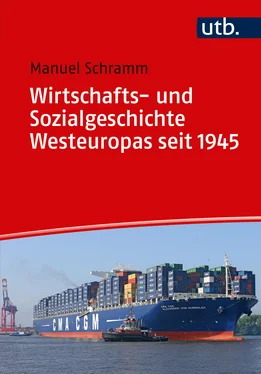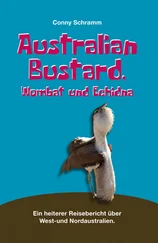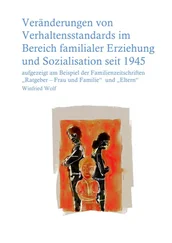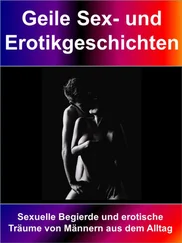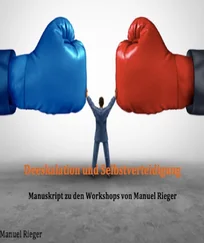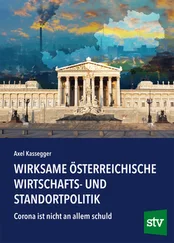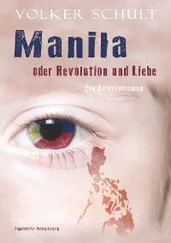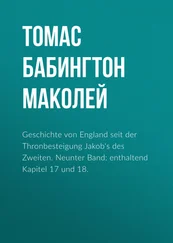1In alphabetischer Reihenfolge: Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Finn-land, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Vereinigtes Königreich. Die einzige größere territoriale Veränderung seit 1949 betraf die Vereinigung der beiden deutschen Staaten 1990.
2Verschiedentlich ist eingewendet worden, dass der entscheidende Durchbruch zum Massenkonsum eher am Ende der fünfziger Jahre gelegen habe, da erst dann die Arbeiter am zunehmenden Konsum vor allem langlebiger Güter partizipiert hätten. Das ist zwar zutreffend. Aber eine Zäsur etwa 1958 oder 1959 zu setzen, erscheint doch willkürlich, denn die Ausbreitung des Massenkonsums setzte bereits zu Beginn der fünfziger Jahre ein, mit der „Fresswelle“, auf die die „Bekleidungswelle“ und dann die „Einrichtungswelle“ folgten. Warum sollten überhaupt die Arbeiter und nicht die Mittelschichten der Bezugspunkt sein? Warum langlebige Konsumgüter und nicht die Ernährung?
1Hungerjahre (1945–1950)
1.1Rationierung und Schwarzmarkt
Viele zeitgenössische Aussagen dokumentieren, dass die Suche nach Nahrungsmitteln und Brennstoff in der unmittelbaren Nachkriegszeit den Alltag der Menschen bestimmte. Mehr als politische oder gesellschaftliche Fragen dominierten triviale Alltagsprobleme das Denken und die Konversationen. Insbesondere den Frauen fiel häufig die Aufgabe zu, den schwierigen Alltag zu organisieren, sich Informationen zu beschaffen, wann was wo zu bekommen sei, Schlange zu stehen, die beschränkten Kochzeiten zu planen und den Mangel zu verwalten. Insofern ist es nur recht und billig, die Geschichte der Nachkriegszeit mit diesen Alltagsproblemen zu beginnen und die insgesamt besser erforschten politischen Fragen in den folgenden Kapiteln zu behandeln.
Grundsätzlich war der Konsum zwischen Kriegsende und ca. 1949 geprägt von der Rationierung. Insofern ist die Kennzeichnung der Nachkriegsgesellschaften als „Rationen-Gesellschaften“ (Rainer Gries) durchaus zutreffend, auch wenn man in manchen Fällen vielleicht eher von „Schwarzmarkt-Gesellschaften“ sprechen sollte, da in vielen Städten und Regionen (insbesondere in Italien) dem Schwarzmarkt eine wichtigere Rolle für die Versorgung zukam als den offiziellen Rationen. Zunächst ist es aber wichtig zu verstehen, dass die Versorgung (und damit ein großer Teil des All-tags) in diesen Gesellschaften nach einem ganz anderen Muster funktionierte, als wir das heute gewohnt sind, denn viele Güter des täglichen Bedarfs (nach Ort und Zeit verschieden) wurden nicht frei verkauft, sondern waren rationiert oder unterlagen Preiskontrollen. Die Rationierung konnte verschiedene Formen annehmen, in jedem Fall aber war sie ein sehr bürokratisches Verfahren, das sowohl den Behörden wie auch den Konsumenten viel Geduld abverlangte. Die Vorteile des Rationierungssystems, wenn es denn funktionierte, waren eine grundsätzlich gerechte Verteilung knapper Güter. Daraus bezog die Rationierung sogar eine gewisse soziale Akzeptanz, wenn und solange sie als gerecht empfunden wurde wie beispielsweise in Großbritannien. Leider blieb das die Ausnahme, und zu den unerwünschten, aber kaum zu vermeidenden Begleiterscheinungen der Rationierung gehörten alternative Beschaffungsformen, legale, halblegale und illegale: der Schwarzmarkt, Hamsterfahrten, Paketsendungen, Horten, Tauschgeschäfte und anderes mehr.
Oberflächlich betrachtet glichen sich die „Rationen-Gesellschaften“ weitgehend. Überall musste man Schlange stehen, überall kam es zu mehr oder weniger spontanen Protesten, überall unternahm man Hamsterfahrten oder handelte auf dem Schwarzmarkt. Die westeuropäischen Gesellschaften der Nachkriegszeit unterschieden sich in dieser Hinsicht kaum von denen des Ersten oder Zweiten Weltkrieges. Der Teufel steckte jedoch im Detail.
Schon die Ausgangslage war sehr unterschiedlich. Die Länder, die unter deutsche Besatzung geraten waren, wurden vom NS-Regime nach rassischen Kriterien, aber auch nach dem Grad des Widerstands, den sie geleistet hatten, sehr unterschiedlich behandelt. Grundsätzlich waren die Rationen in den osteuropäischen Gebieten niedriger als in den westeuropäischen, aber auch Westeuropa wurde zugunsten des Großdeutschen Reiches ausgeplündert. Während Dänemark großzügig versorgt wurde und die Rationen hier teilweise höher waren als in Deutschland (ca. 2000 Kalorien pro Kopf und Tag), waren die Rationen in Italien ähnlich niedrig wie in Polen und reichten mit ca. 1000 Kalorien pro Kopf und Tag 1942/43 als Normalration kaum zum Überleben. Nicht viel besser war die Lage in Frankreich von 1942 an mit ca. 1100 Kalorien pro Kopf und Tag. Die Niederlande erlebten einen katastrophalen Hunger-winter 1944/45, ähnlich wie Griechenland bereits 1941/42. In Deutschland wurde die Versorgungslage erst gegen Ende des Krieges angespannt, als aufgrund des Vorrückens der Alliierten die Ausplünderung der besetzten Gebiete nicht mehr möglich war. Trotz der unterschiedlichen Höhe war das Rationierungssystem im Prinzip überall gleich. Die Einteilung der Bevölkerung erfolgte zum einen nach Alter, wobei Erwachsene die so genannte „Normalration“ erhielten, und zum anderen nach der Art der verrichteten Arbeit. So gab es Zulagen für Industriearbeiter, die zwischen 15 und 50 Prozent der Normalration lagen (1944), und für Schwerarbeiter, die zwischen 20 und 100 Prozent der Normalration variierten. Dieses System spiegelte die enorme Bedeutung der Industriearbeit für die Besatzungsmacht wider, da sie die Fortführung des Krieges gegen die überlegenen Alliierten ermöglichte.
Da die Ausplünderung der besetzten Länder kaum geheim gehalten werden konnte, erhofften sich viele Menschen von der Befreiung durch die Alliierten eine schlagartige Verbesserung der Lage. Umso größer war die Enttäuschung, als dies nicht geschah. Zunächst waren die alliierten Streitkräfte auf zivile Verwaltungsaufgaben nur schlecht vorbereitet. Hinzu kam, dass das Ausmaß der Versorgungskrise beispielsweise in Italien die vorrückenden Truppen stark überraschte. So verbesserte sich die Versorgungslage nur langsam und die Rationierung wurde, wenn auch von Land zu Land unterschiedlich, noch jahrelang beibehalten. Teilweise verschlechterte sich die Lage sogar. In Frankreich wurden die Brotrationen nach Kriegsende von 350 g pro Tag und Person erst auf 300 g und dann auf auf 250 g gesenkt. In Großbritannien wurde Brot erst 1946, also ein Jahr nach Kriegsende, rationiert, und war erst 1948 wieder frei verfügbar. Auch in Deutschland wurden die Brotrationen im Frühjahr 1946 gekürzt. Hier war das „Hungerjahr“ 1947 die wohl schwierigste Zeit dieser Periode, beispielsweise in Köln, wo die Rationen im April 1947 so stark gekürzt wurden, dass ihr Nährwert von ca. 1100 Kalorien für den Normalverbraucher auf 900 (und zeitweise noch darunter) fiel.
Die Rationierungssysteme unterschieden sich teilweise deutlich voneinander. Das nationalsozialistische System der Kriegswirtschaft sah nach Lebensaltern gestaffelte Rationen mit Zulagen für besondere Gruppen vor. In den meisten Ländern, so auch in den westlichen Besatzungszonen Deutschlands, wurde dieses System beibehalten, wenn auch mit Modifikationen. Die größte Gruppe bildeten die erwachsenen Normalverbraucher, Zulagen wurden für Schwer- und Schwerstarbeiter gewährt, für stillende und werdende Mütter, für Kranke, Alte, Schwerbeschädigte, politisch Verfolgte und ehemalige KZ-Häftlinge. Völlig anders war die Rationierung in der sowjetischen Besatzungszone geregelt, wo (bis 1947) sechs Gruppen unterschieden wurden, die jeweils eigene Lebensmittelkarten erhielten: Schwerstarbeiter, Schwerarbeiter, Arbeiter, Angestellte, Kinder und Sonstige. Berüchtigt waren vor allem die Hungerrationen für die Kategorie der „Sonstigen“, in die Hausfrauen, ehemalige Nazis, Rentner und nicht arbeitende Besitzer von Betrieben eingruppiert wurden: Ihre Lebensmittelkarte wurde im Volksmund als „Friedhofskarte“ bezeichnet. Dagegen war die Intelligenz, die meist bei den Arbeitern eingruppiert wurde, sogar zunächst besser gestellt als in den westlichen Besatzungszonen. Ein wiederum ganz anderes Rationierungssystem herrschte in Großbritannien vor. Dort verzichtete die Regierung auf eine Differenzierung der Bevölkerung (ausgenommen Kinder unter sechs Jahren) und jeder erhielt dieselbe Ration (mit wenigen Ausnahmen für Schwangere, stillende Mütter und bestimmte Gruppen von Arbeitern). Erst im Oktober 1946 wurde eine zusätzliche Fleischration für Bergarbeiter eingeführt. Das Prinzip der Flatrate-Rationen war deswegen unproblematisch, weil ohnehin nur ein Teil der Lebensmittel rationiert war (v.a. Zucker, Butter, Schinken, Fleisch, zeitweise auch Brot), die Konsumenten also auf frei verfügbare Waren ausweichen konnten.
Читать дальше