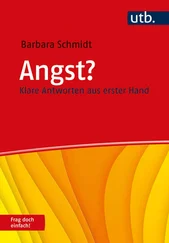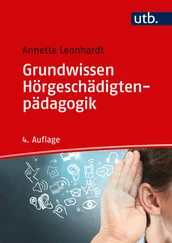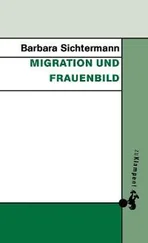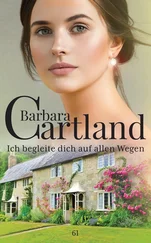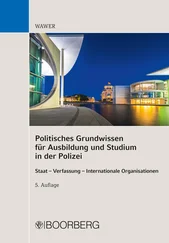„Die geringe Wirtschaftskraft der DDR verhinderte den Ausbau der Infrastruktur des Bildungs- und Betreuungswesens.
„Die geringe Wirtschaftskraft der DDR verhinderte den Ausbau der Infrastruktur des Bildungs- und Betreuungswesens.
 Es fehlten Interessen- und Elternverbände – wie in der Bundesrepublik etwa die Lebenshilfe –, die sich für die Belange geistig behinderter Menschen einsetzten.
Es fehlten Interessen- und Elternverbände – wie in der Bundesrepublik etwa die Lebenshilfe –, die sich für die Belange geistig behinderter Menschen einsetzten.
 Die verhältnismäßig geringe Zahl von Personen, die beruflich oder privat in engem Kontakt mit geistig behinderten Menschen waren, reichte nicht aus, um eine größere Öffentlichkeit zu erreichen und Druck bei politischen Entscheidungsträgern aufzubauen“ (2007, 218).
Die verhältnismäßig geringe Zahl von Personen, die beruflich oder privat in engem Kontakt mit geistig behinderten Menschen waren, reichte nicht aus, um eine größere Öffentlichkeit zu erreichen und Druck bei politischen Entscheidungsträgern aufzubauen“ (2007, 218).
Eine vergleichende Gegenüberstellung der Entwicklungen in den beiden deutschen Staaten zwischen 1946 und 1989 befindet sich im Anhang.
Mit dem Einigungsvertrag von 1990 geht die „Nachkriegszeit auch der Sonderpädagogik“ (Ellger-Rüttgardt 2008, 329) zu Ende. „Wie auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen, wurde das System sonderpädagogischer Hilfen in den neuen Bundesländern weitgehend nach dem Muster der alten Bundesrepublik neu gestaltet“ (ebd.). Dies wird heute kritisch gesehen:
„Abschließend bleibt zu sagen, dass viele der teils guten Ansätze der Rehabilitationspädagogik mit der Wiedervereinigung verloren gegangen sind. Dies ist insofern bedauernswert, als dass ihre Erkenntnisse und Entwicklungen ein Gewinn für eine gesamtdeutsche Heilpädagogik hätten sein können“ (Barsch 2007, 218).

Barsch, S. (2007): Geistig behinderte Menschen in der DDR. Oberhausen
Ellger-Rüttgardt, S. L. (2008): Geschichte der Sonderpädagogik. München
Möckel, A. (2007): Geschichte der Heilpädagogik. Stuttgart
2.5Geistigbehindertenpädagogik im Umbruch
Innerhalb des Systems der Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderung haben sich seit Anfang der 1990er Jahre zahlreiche Veränderungen vollzogen. Sie beziehen sich auf das Verständnis von Behinderung, auf Behindertenrecht und -politik sowie auf die erkenntnis- und handlungsleitenden Prinzipien der Geistigbehindertenpädagogik und Rehabilitation. Während in der Aufbauphase erst ein Bewusstsein für die Belange von Menschen mit geistiger Behinderung geschaffen werden musste, wurde bis Ende der 1980er Jahre das System der speziellen Hilfen differenziert ausgebaut.
Phase des Umbaus
 Segregation
Segregation
In den 1990er Jahren mehrte sich die Kritik an der mit dem Ausbau verbundenen Segregation. Forderungen nach mehr Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Teilhabe markieren einen Prozess der Umgestaltung, des Umbaus des Versorgungssystems, der bis heute noch nicht abgeschlossen ist und der sich mit Dederich folgendermaßen beschreiben lässt:
„Schrittweise hat sich ein Prozess der Humanisierung vollzogen, hin zu verbesserter rechtlicher Gleichstellung, sozialer Eingliederung und sozialer Teilhabe. Die Kritik an Segregation und Diskriminierung sowie die Forderung nach Nichtaussonderung und Selbstbestimmung durch die Behindertenbewegung waren für diesen Prozess ebenso bedeutsam wie die Bemühungen um schulische, berufliche und soziale Integration (neuerdings zunehmend abgelöst durch Inklusion), die Rezeption des Empowermentkonzeptes und die Entwicklung neuer Hilfekonzepte, das grundgesetzlich verankerte Diskriminierungsverbot sowie das im Sozialgesetzbuch IX festgeschriebene Prinzip der Teilhabe“ (Dederich 2008, 31).
Dieser Entwicklungsprozess hat zu einer deutlichen Verbesserung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit geistiger Behinderung geführt und zeigt sich beispielsweise in der Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Schulformen (staatliche oder private Sonderschulen oder integrative Schule), der Möglichkeiten zur Mitbestimmung (in Wohnheim- oder Werkstattbeiräten), der Selbstbestimmung durch ‚Persönliches Budget’ und Mitsprache bei der individuellen Lebens- und Hilfebedarfsplanung, dem Leben in der Gemeinde oder in Partnerschaft und begleiteter Elternschaft, der Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt mit Hilfe von Arbeitsassistenz, in der Beteiligung an der Fußballweltmeisterschaft der Behinderten und den Paralympics sowie im Leben der eigenen Kultur (Theater, Musikvereine, Schreib- und Leseklubs) und vieles andere mehr (Fornefeld 2008, 14f).
Die pädagogischen und rehabilitativen Leitgedanken, die diese positive Entwicklung begleiteten, sind neben den in den 1970er Jahren eingeführten Prinzipien der ‚Normalisierung‘ und ‚Integration‘, die Idee der ‚Selbstbestimmung‘, des ‚Empowerments‘ und der ‚Teilhabe‘.
 Normalisierung
Normalisierung
Unter Normalisierung versteht man den 1959 von dem Dänen Bank-Mikkelsen entwickelten Leitgedanken zur Angleichung der Lebensmuster und Alltagsbedingungen von Menschen mit geistiger Behinderung an die üblichen Bedingungen der Gesellschaft, in der sie leben (normaler Tagesrhythmus, normaler Wochen- und Jahresablauf, normale Erfahrungen eines Lebenszyklus, normaler Respekt, in einer zweigeschlechtlichen Welt leben, normaler Lebensstandard, normale Umweltbedingungen). Das Normalisierungsprinzip will zur Humanisierung der Lebensbedingungen beitragen und ist das erste Konzept der Heilpädagogik und Behindertenhilfe, das sich konsequent „von der Leitidee der Fremdbestimmung“ (Greving/Ondracek 2005, 158) abwendet. Es wurde durch die wissenschaftliche und konzeptionelle Weiterentwicklung des Schweden Bengt Nirje und des Amerikaners Wolf Wolfensberger in den 1960er und 1970er Jahren zu einer handlungsleitenden methodischen Orientierung. In Deutschland hat vor allem Walter Thimm das Prinzip eingeführt und weiterentwickelt. Wie in Kapitel 4.5 noch gezeigt wird, war das Normalisierungsprinzip bei der Auflösung und Umgestaltung der großen Anstalten von Bedeutung.
 Integration
Integration
Die Leitidee der Integration geht zum Teil aus dem Normalisierungsprinzip hervor und will die Eingliederung ausgesonderter Personengruppen in die Gesellschaft erreichen. Wie in Kapitel 3.5 gezeigt wird, entstand die Leitidee Mitte der 1970er Jahre als Folge der Empfehlung des Deutschen Bildungsrates zur gemeinsamen Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderung. Integration versteht sich heute sowohl als Wertbegriff (Bejahung des Lebenswertes behinderter Menschen, Bejahung des menschlichen Grundbedürfnisses nach Teilhabe am sozialen Leben und Aufhebung künstlicher Trennung) als auch als Handlungsbegriff (räumliche, funktionelle, soziale, personale, gesellschaftliche und organisatorische Integration). Die Leitidee liefert somit die anthropologische Grundlage für ein verändertes Erziehungsverständnis (Fornefeld 2008, 108f). Obwohl die Integration zurzeit stark im schulischen Kontext diskutiert wird, ist sie auch in anderen Lebensbereichen von Bedeutung (z.B. in den Bereichen des Wohnens und Arbeitens oder in der Integrativen Erwachsenenbildung, Kap. 4).

Abb. 10: inklusiver Lea-Leseklub®
Читать дальше
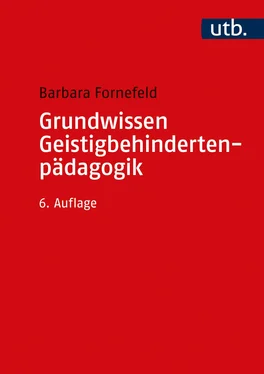
 „Die geringe Wirtschaftskraft der DDR verhinderte den Ausbau der Infrastruktur des Bildungs- und Betreuungswesens.
„Die geringe Wirtschaftskraft der DDR verhinderte den Ausbau der Infrastruktur des Bildungs- und Betreuungswesens.
 Segregation
Segregation