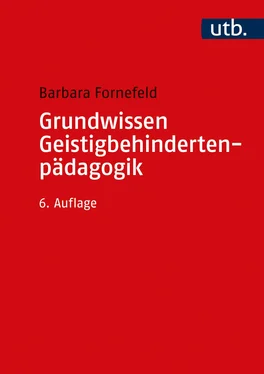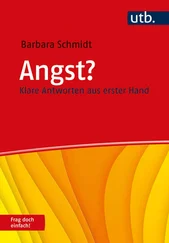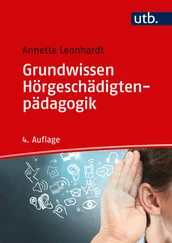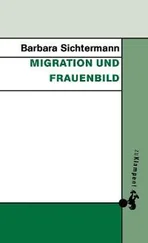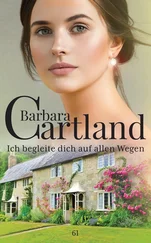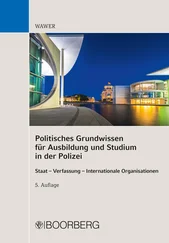Ausschluss von Schülern mit geistiger Behinderung in beiden Staaten
Eine systematische Beschulung begann hier aber erst Anfang der 1960er Jahre. Erschwerend kam hinzu, dass das Reichsschulpflichtgesetz von 1938 weiterhin Gültigkeit besaß und Schüler mit geistiger Behinderung darin für bildungsunfähig erklärt wurden.
In der DDR erfolgte die Ausschulung von Schülern mit geistiger Behinderung auf der Grundlage des Schulgesetzes für Groß-Berlin, „in dem das eingeschränkte Bildungsrecht für Schwerbehinderte in den Punkten 6 und 8 festgeschrieben wurde und in fataler Weise an das Reichsschulpflichtgesetz von 1938 erinnert“ (Ellger-Rüttgardt 2008, 314). Auf dieser Grundlage sprach man denjenigen Kindern und Jugendlichen ein Recht auf schulische Erziehung und Bildung ab, die nicht Lesen, Schreiben und Rechnen lernen konnten. Hier heißt es:
„Kinder mit geistigen, körperlichen und sittlichen Ausfallerscheinungen und Schwächen, die aber noch bildungs- und erziehungsfähig sind, werden besonderen Schulen und Heimen zugewiesen (Hilfsschulen, Sonderschulen für Schwererziehbare, Blinde, Taubstumme, Krüppel usw.) […] Bildungsunfähige Kinder und Jugendliche sind von der Schulpflicht befreit“ (Köhlitz 1949, 20f nach Ellger-Rüttgardt 2008, 314).
Eine Befreiung von der Schulpflicht aufgrund von Bildungsunfähigkeit sahen auch die in den 1960er und 1970er Jahren in der BRD erlassenen Gesetze vor. „Das traf Eltern schwer geistig behinderter Kinder. Sie sollten sich allein behelfen, obgleich gerade sie die Hilfe des Staates brauchten“ (Möckel 2007, 233f). Nach diesen einleitenden Bemerkungen zur Einstellung gegenüber Kindern mit geistiger Behinderung in beiden deutschen Staaten soll nun die Entwicklung der Bildungs- und Versorgungssysteme bis 1989 genauer betrachtet werden. Vorab ist zu bemerken, dass Kinder und Jugendliche im Vordergrund standen, schließlich gab es wegen der nationalsozialistischen Vernichtungsaktionen nur noch wenige Erwachsene mit geistiger Behinderung.
2.4.1Entwicklung in der BRD
Gründung der „Lebenshilfe“
Gegen das staatliche Desinteresse wandten sich in den 50er Jahren vor allem in Anstaltsschulen tätige Pädagogen, forderten eine öffentliche Schulbildung für diese Schülergruppe und die Aufhebung der unteren Bildungsgrenze, die sich am bestehenden Hilfsschulsystem und dem Erlernenkönnen von Kulturtechniken orientierte. Doch es erfolgte noch keine Umsetzung dieser Forderung, der Bildungsanspruch dieser Kinder war nicht allgemein anerkannt. Selbst im „Gutachten der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder zur Ordnung des Sonderschulwesens“ von 1960 wird im letzten Abschnitt zwar die Bildbarkeit dieser Kinder bestätigt, „aber diese wird als so gering angesehen, daß der angenommene Personenkreis weder in Schulen noch in Heilpädagogischen Kindergärten gefördert werden kann“ (Speck 1979, 70). Es waren vor allem die Kritik und die Initiative von betroffenen Eltern, die zu einer entscheidenden Veränderung der Bildungssituation für geistig behinderte Kinder führte und den Aufbau eines Bildungs- und Versorgungssystems ermöglichte. Die Intention der Eltern war es, ihre Kinder familiennah versorgt zu wissen und nicht in abgelegene Anstalten abgeben zu müssen. In Anlehnung an Elternvereinigungen, wie sie bereits in England, den Niederlanden oder den USA bestanden, schlossen sich Eltern um die kreative Gründungspersönlichkeit des Niederländers Tom Mutters zusammen und gründeten 1958 in Marburg die „Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind e.V.
„Aufgabe und Zweck des Vereins ist die Förderung aller Maßnahmen und Einrichtungen, die eine wirksame Lebenshilfe für geistig Behinderte aller Altersstufen bedeuten. Dazu gehören z.B. Heilpädagogische Kindergärten, heilpädagogische Sonderklassen der Hilfsschule, Anlernwerkstätten und ‚Beschützende Werkstätten‘“ (§2 der Satzung des Vereins vom 18.1.1959 nach Möckel 1999, 158).
Auf Initiative der „Lebenshilfe“ entstand in den Folgejahren eine Vielzahl von Einrichtungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit geistiger Behinderung. Die Zahl der Kindergärten für geistig Behinderte stieg im Zeitraum von 1962 bis 1982 von 10 auf 410, die von Schulen bzw. Tagesbildungsstätten im selben Zeitraum von 50 auf 550.
Aufbauphase
In den 1960er Jahren, der Aufbauphase, wurde in fast allen westlichen Bundesländern die Schulpflicht für Kinder mit geistiger Behinderung gesetzlich verankert. Es wurden weitere Schulen gegründet und bestehende hortähnliche Tagesbildungsstätten in Sonderschulen für Geistigbehinderte umgewandelt. Es entstanden Richtlinien und Lehrpläne für den Unterricht. Mit der Forderung des Deutschen Bildungsrates, dass die Grundschule für die Bildung aller Kinder zuständig sei, begann 1973 die Diskussion um die gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderungen und zwischen 1970 und 1987 die ersten integrativen Schulversuche in München, Berlin, Hamburg, Bonn und Köln.
Ausbauphase
Mit der Einführung des Bundessozialhilfegesetzes 1961 wurde das Recht auf Sozial- und Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung festgelegt, womit sie nicht länger auf Fürsorge angewiesen waren. Dieses Gesetz schaffte die Grundlage zum Ausbau des Versorgungssystems für Menschen mit geistiger Behinderung in den 1970er und 1980er Jahren. Es entstanden Frühfördereinrichtungen, Werkstätten für Behinderte, Wohnheime, Erwachsenenbildungs- und Freizeiteinrichtungen, auf deren Entwicklung ich in den nachfolgenden Kapiteln noch genauer eingehen werde. Das Aufgabengebiet der Geistigbehindertenpädagogik weitete sich immer mehr aus und ließ ein komplexes System von Hilfen und Maßnahmen entstehen, wie es im ersten Kapitel beschrieben wurde. Entwickelt wurde es in der Praxis, d.h. es geht auf Menschen zurück, die sich in besonderer Weise für die Belange dieses Personenkreises eingesetzt haben. Sie bewirkten, dass Einrichtungen, Erziehungs- und Betreuungskonzepte entstanden und die juristischen Grundlagen hierfür geschaffen wurden.
2.4.2Entwicklung in der DDR
Der Wiederaufbau des Schulwesens in der Sowjetischen Besatzungszone war geprägt vom Streben nach Demokratisierung des Bildungswesens (vgl. §6 des „Gesetz[es] zur Demokratisierung der deutschen Schule“ von 1946).
„Es war zweifellos die historische Erfahrung der menschenverachtenden Behindertenpolitik des Nationalsozialismus und das damit verbundene Bestreben einer sich selbst legitimierenden Abgrenzung gegenüber dieser Epoche deutscher Geschichte, die bewirkte, dass die Interessen behinderter Schüler von Anfang an Eingang in die allgemeine Debatte um den Bildungsaufbau in der Ostzone fand“ (Ellger-Rüttgardt 2008, 311).
Aufbauphase
„Die revolutionären Veränderungen im Bildungswesen bewirkten auch im Bereich der Sonderschulen einen Wiederaufbau in historisch neuer Qualität“ (Baudisch et al. 1987, 16). Doch die ab 1948 einsetzende ‚Sowjetisierung‘ und ‚Ideologisierung‘ hatte für die Hilfsschulen im Gegensatz zu den allgemeinen Schulen kaum Bedeutung. Ab den 1960er Jahren wurden, so meint Barsch, sonderpädagogische bzw. rehabilitationspädagogische Theorie „auf der Basis des Sozialismus entwickelt, auch wenn dies für die praktische Arbeit in den Schulen und Fördereinrichtungen nur von geringer Bedeutung war“ (2007, 52f).
Kinder mit geistiger Behinderung wurden im Aufbau des Hilfsschulwesens zwar mitgedacht, aber in der Praxis nicht integriert, weil sie bis 1989 als bildungsunfähig galten. Diese Separierung nimmt das Schulpflichtgesetz von 1950 vor, indem es körperlich und geistig behinderte Schulpflichtige, die als schulbildungsunfähig galten, dem Ministerium für Gesundheitswesen der DDR zuordnete.
Professor Sigmar Eßbach von der Humboldt-Universität in Ost-Berlin beschreibt diese Entwicklung 1985: „Für die schulbildungsunfähigen Kinder und Jugendlichen war nicht die Volksbildung, sondern das Gesundheitswesen zuständig. Auf Grund einer mangelnden Quellenlage ist nur wenig über die Bildungs- und Betreuungsbedingungen dieser Population bekannt. Es gab in der SBZ (So-Besatzungszone, Anm. B. F.) noch keine Fördereinrichtungen, die sich sinnigen“ nachder ‚schulbildungsunfähigen‘ förderfähigen Kindern annahm. Der überwiegende pädagogischen Teil dieser Gruppe wurde in speziellen Klassen in den Hilfsschulen beschult, bis seit etwa Mitte der 1950er Jahre zunehmend die Forderung laut wurde, ‚im Interesse der Optimierung des Unterrichts in den Hilfsschulen die sog. ‚bildungsunfähigen‘ schwachsinnigen Kinder auszuschulen‘“ (nach Barsch 2007, 50). Während die leicht geistig behinderten Kinder weiter in den Hilfsschulen (in den Abteilungen II) unterrichtet und so weit als möglich in die sozialistische Gesellschaft integriert wurden, gab es für die Gruppe der Kinder mit schwerer Behinderung (IQ <20) weder Recht auf Beschulung, noch auf Betreuung (Barsch 2007, 50). Sie fanden, wenn sie nicht von der Familie versorgt werden konnten, Aufnahme in psychiatrischen und neurologischen Abteilungen von Krankenhäusern. Diese Personengruppe war in mehrfacher Hinsicht benachteiligt, weil für sie neben fehlenden Bildungseinrichtungen auch kein flächendeckendes Wohnangebot bestand (Barsch 2007, 216). Viele Menschen mit geistiger Behinderung lebten unter schlechten Bedingungen in psychiatrischen Einrichtungen, ohne dass dafür medizinische Indikationen vorlagen. Die Bildungs- und Freizeitangebote für sie waren überaus gering. In den wenigen verbliebenen kirchlichen Einrichtungen waren die Versorgung und das pädagogische Angebot besser.
Читать дальше