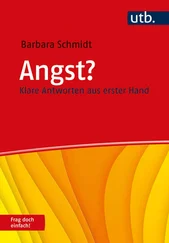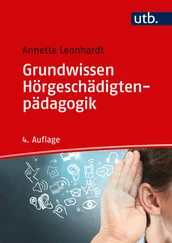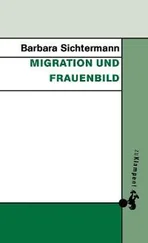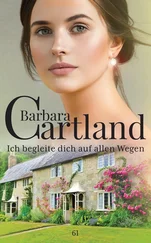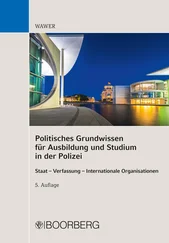2.4Die Entwicklung der Geistigbehindertenpädagogik von 1945 bis 1989 in beiden deutschen Staaten
Es ist schwierig, eine gesamtdeutsche Entwicklung der Geistigbehindertenpädagogik nach Ende des Zweiten Weltkrieges nachzuzeichnen. Bislang gibt es keine systematische Erforschung der Nachkriegszeit in den vier Besatzungszonen bzw. den späteren beiden deutschen Staaten. Die Gründe hierfür sind vielfältig, wie z.B. :
 Konzentration auf den Wiederaufbau und die Wiedererrichtung des Bildungs- und Versorgungssystems für Menschen mit Behinderung,
Konzentration auf den Wiederaufbau und die Wiedererrichtung des Bildungs- und Versorgungssystems für Menschen mit Behinderung,
 Zukunftsorientierung bei gleichzeitiger Verdrängung der geschichtlichen Ereignisse, wie der systematischen Ermordung von Menschen mit geistiger Behinderung und Vernichtung von historischem Material in den Anstalten bei Kriegsende,
Zukunftsorientierung bei gleichzeitiger Verdrängung der geschichtlichen Ereignisse, wie der systematischen Ermordung von Menschen mit geistiger Behinderung und Vernichtung von historischem Material in den Anstalten bei Kriegsende,
 unterschiedliche ideologische Interessen in beiden deutschen Staaten mit der Ausbildung von Vorurteilen gegenüber den Entwicklungen im jeweils anderen Teil.
unterschiedliche ideologische Interessen in beiden deutschen Staaten mit der Ausbildung von Vorurteilen gegenüber den Entwicklungen im jeweils anderen Teil.
Aufbau des Bildungs- und Versorgungssystems
Da die historische Aufarbeitung im Sinne einer zeitgeschichtlichen Historiografie der Geistigbehindertenpädagogik erst beginnt, werden hier nur einige Aspekte der Entwicklung zwischen 1945 und 1989 in beiden deutschen Staaten so dargestellt, wie sie sich heute zeigen: Bildungs- und Versorgungssysteme für Menschen mit geistiger Behinderung wurden auf- und ausgebaut. Sie unterschieden sich auf ideologischer und juristischer Ebene von einander, während sie auf der Ebene der pädagogischen Praxis Parallelen aufweisen. Nach der Vereinigung in den 1990er Jahren setzte dann in der gesamtdeutschen Behindertenhilfe eine umfassende Neuorientierung, eine Periode des Umbaus ein, die bis heute andauert und auf die ich in Kapitel 2.5näher eingehen werde.
Das Bildungswesen für Kinder mit geistiger Behinderung hatte durch die Ereignisse zwischen 1934 und 1945 „substantiellen Schaden“ (Speck 1979, 68) genommen. „Schwer schwachsinnigen“ Kindern, wie man geistig behinderte Menschen damals weiterhin nannte, gestand man keine Bildungsfähigkeit zu, obgleich Artikel 1 des 1949 in Kraft getretenen Grundgesetzes der Bundesrepublik die Unantastbarkeit der Würde des Menschen festschreibt. Man betrachtete Kinder mit geistiger Behinderung vordringlich als pflegebedürftig, weil man davon ausging, sie könnten den kulturellen Inhalten des Unterrichtes in der Hilfsschule nicht folgen. Weder ihre Lebenssituation noch ihre humanen Ansprüche waren von gesellschaftlichem Interesse, was nicht verwundert, wenn man sich die Lebensbedingungen der Menschen im Deutschland der frühen Nachkriegsjahre vor Augen führt: „Zunächst dauerte es im kriegszerstörten Deutschland jedoch ein Menschenalter, bis die äußeren Trümmer und die seelischen Verwüstungen einigermaßen weggeräumt und im Sonderschulwesen auch nur der Stand aus 1933 wieder erreicht war. Die Sonderpädagogik knüpfte dort an, wo sie 1933 aufgehört hatte“ (Möckel 2007, 208). Die Anstalten setzten ihre Arbeit fort und bildeten den einzigen außerfamiliären Lebensort für Menschen mit geistiger Behinderung in der Nachkriegszeit. Obwohl die Instandsetzung des Bildungssystems, zu dem auch die Hilfsschulen gehörten, vordringliches Ziel war, rückten die Kinder und Jugendlichen mit geistiger Behinderung erst in den 1960er Jahren ins Blickfeld, weil sie noch immer für bildungsunfähig gehalten wurden.
„Unterschiede im Aufbau des Sonderschulwesens nach Kriegsende bestanden nicht nur in regionaler Hinsicht, sondern auch in Abhängigkeit von den jeweiligen Sonderschularten. Während Bildungseinrichtungen für Kinder mit einer geistigen Behinderung – von Anstalten abgesehen – auch in den unmittelbaren Nachkriegsjahren so gut wie nicht existierten, setzte beispielsweise der Wiederaufbau der Schulen und Klassen für schwerhörige Kinder rasch und zügig ein“ (Ellger-Rüttgardt 2008, 300).
In der Zeit des Aufbaus des Hilfsschulwesens, der in der Sowjetischen Besatzungszone 1946 mit dem Inkrafttreten des „Gesetzes zur Demokratisierung der deutschen Schule“ und in den westlichen Besatzungszonen 1948 mit dem Hinweis der „Deutschen Erziehungsminister“ auf die schwierige Situation der Schul-kinder begann, versuchte man zunächst an die Tradition der Heilpädagogik während der Weimarer Republik, d.h. an das Bildungs- und Versorgungssystem, wie es vor 1933 bestand, anzuknüpfen. Dabei fand eine „Tabuisierung des ‚Dritten Reiches‘“ (Ellger-Rüttgardt 2008, 294) statt. Während man im Westen die eigene Geschichte weitgehend verdrängte, grenzte man sich im Osten von ihr bewusst ab, um hierdurch die sozialistische Staatsideologie legitimieren zu können. Viele der in der NS-Zeit in den Einrichtungen tätigen Heilpädagogen nahmen ihre Arbeit in Anstalten, Hilfsschulen oder in den Verwaltungen wieder auf, ohne Verantwortung für ihr Handeln und das Geschehene zu übernehmen. Man wollte auch nicht die heute offensichtlichen Schwächen einer Sonderpädagogik der Vorkriegszeit sehen, die von einer Vorstellung ausging, dass „Heilerziehung ausschließlich die Fortsetzung ärztlicher Behandlung mit anderen Mitteln“ (Möckel 2007, 207) sei. Man musste erst zu einer Neubewertung von geistiger Behinderung und zu neuen humanen Werten gelangen, um die Ansprüche von Menschen mit geistiger Behinderung wahrnehmen und ihr Bildungsrecht durchsetzen zu können.
In der Bundesrepublik (BRD) geschah dies erst in den 1970er Jahren und nach Vorbildern aus den skandinavischen Ländern und den Vereinigten Staaten, wo neue Formen der Normalisation der Lebensbedingungen von Menschen mit geistiger Behinderung sowie deren Integration realisiert wurden. Einen weiteren, wenn auch nicht direkten Einfluss hatte die von der Studentenrevolte 1968 angestoßene Demokratisierung der westdeutschen Gesellschaft (vgl. Ellger-Rüttgardt 2008, 304). Durch deren Forderung, auch unterprivilegierten Kindern mehr Bildungschancen zu bieten, gerieten die Folgen der Benachteiligung stärker ins Blickfeld. Man erkannte, dass Beeinträchtigung und Behinderung auch Folge soziale Benachteiligung sein können. Dies führte Mitte der 1970er Jahre zur Abkehr vom ausschließlich medizinischen Verständnis von Behinderung und zur Auflösung des weitgehend statisch-biologischen Begabungsbegriffs. Die Diskussion um die gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderung setze ein. Diese Entwicklung wurde in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) nicht vollzogen. Unter dem Einfluss der Defektologie, wie die Behindertenpädagogik und -psychologie in der Sowjetunion bezeichnet wurde, blieb die Orientierung am medizinischen Modell in den Rechtsvorschriften der DDR bis 1989 weiter bestehen.
Schaut man noch einmal genauer auf die Anfänge der Bildungs- und Versorgungssituation der Menschen mit geistiger Behinderung, so ist die Lage der Sonderschulen nach 1945 im Vergleich zu anderen Bildungseinrichtungen als besonders katastrophal einzuschätzen (Ellger-Rüttgardt 2008, 298). Es fehlte an allem, an Lehrerinnen und Lehrern, an Räumen und an Lehrmaterialien. Die Klassen waren überfüllt. Regelmäßiger Unterricht war kaum möglich. Die Kinder waren oft unterernährt und in einem schlechten gesundheitlichen Zustand. Die Hilfsschulen waren Kindern mit Lern- und Verhaltensproblemen vorbehalten und nahmen das Konzept der Leistungsschule wieder auf. Nur einzelne Schüler mit geistiger Behinderung fanden in den angegliederten Sammelklassen Aufnahme, so z. B. in Berlin, wo 1949 die erste Sammelklasse entstand. In den folgenden zehn Jahren wurden dort 205 Schüler in zehn Klassen unterrichtet (Mühl 1991, 16). Die Bildung von Sammelklassen blieb anfänglich jedoch eher die Ausnahme, da wenig Interesse an der Integration von Schülern mit geistiger Behinderung in die Hilfsschulen bestand. Für die bislang ‚Bildungsunfähigen‘ fand keine schulische Erziehung statt, „beschränkten sich die Ansätze für eine pädagogische Hilfe auf einzelne mehr oder weniger private Initiativen“ (Speck 1979, 69). Diese erstreckten sich im Westen auf hortähnliche Einrichtungen, die auf Anregung von Hilfsschullehrern oder Sozialpädagogen entstanden, über Sammelklassen bis zu Tagesheimschulen.
Читать дальше
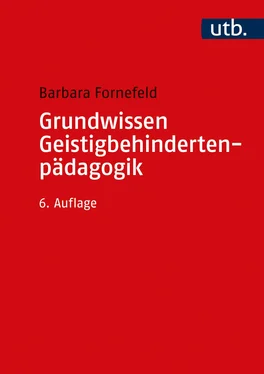
 Konzentration auf den Wiederaufbau und die Wiedererrichtung des Bildungs- und Versorgungssystems für Menschen mit Behinderung,
Konzentration auf den Wiederaufbau und die Wiedererrichtung des Bildungs- und Versorgungssystems für Menschen mit Behinderung,