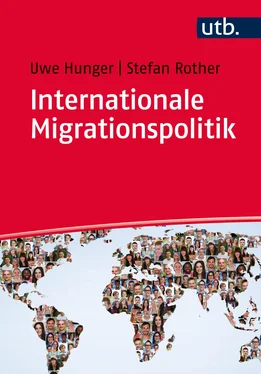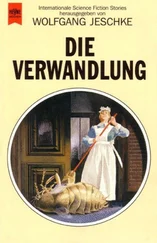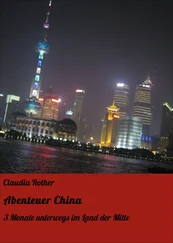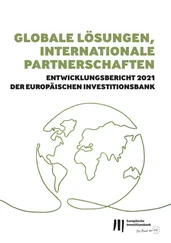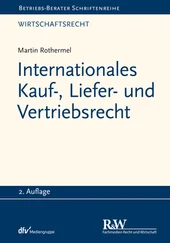1 ...6 7 8 10 11 12 ...20 Die neofunktionalistische Theorie, deren Mitbegründer Ernst B. Haas ist, befasst sich ebenfalls mit vor allem regionaler Kooperation – allerdings aus einer entgegengesetzten Perspektive (Haas 2004): Hier führt Kooperation zur Schaffung supranationaler, also überstaatlicher Institutionen, deren Existenz und bürokratischer Apparat wiederum weitere zwischenstaatliche Kooperation befördert. Der Ansatz ist gut geeignet, die zunehmende Integration der EU, wie etwa auch die Personenfreizügigkeit im Rahmen des Binnenmarkts, zu erklären. Allerdings zeigen die politischen Verwerfungen im Rahmen der Geflüchtetenkrise und etwa der britische Widerstand gegen besagte Binnenfreizügigkeit, dass Integration kein unumkehrbarer Prozess ist, sondern von innerstaatlichen Debatten beeinflusst werden kann.
2.2.4 Der Konstruktivismus
Der Konstruktivismus hat sich in den vergangenen beiden Jahrzehnten zu einer der führenden Theorieschulen im Bereich der internationalen Beziehungen entwickelt, wobei diese eine Vielzahl von Ansätzen umfasst. Kritisch wird vor allem der Prozess der Erkenntnisgewinnung betrachtet: „Die konstruktivistische These besagt, dass die Realität, mit der sich Wissenschaft beschäftigt, nicht objektiv gegeben, sondern kognitiv erzeugt ist.“ (Jensen 1999, S.89) Realität erscheint demnach erst in der Theorie: Erst die Deutung der Beobachtung bringt Realität hervor. Eine objektive Wirklichkeit kann es somit selbst in der Naturwissenschaft nicht geben, da die Gegenstände, mit denen diese sich befasst, nur innerhalb ihrer Beobachtung erscheinen und nicht außerhalb von ihr. Auf die individuellen Menschen bezogen heißt dies, dass das, was sie als Wirklichkeit wahrnehmen, wenn sie darüber reflektieren, nicht einfach gegeben ist. Vielmehr handelt es sich bei dieser Wirklichkeit lediglich um einen Begriff, den der Mensch innerhalb der eigenen Kultur verwendet, um den persönlichen Lebensraum zu bezeichnen.
Eine der führenden Vertreter des Sozialkonstruktivismus in den internationalen Beziehungen ist Alexander Wendt. Der wesentliche Punkt, in dem sich Wendt von den rationalistischen Annahmen früherer Theorieschulen abhebt, ist das Akteursverständnis. Sowohl Neorealismus als auch Neoliberalismus gehen davon aus, dass die Staaten Interessen haben, die durch die anarchische Struktur des Staatensystems kausal bedingt sind. Wendt hält dagegen, dass Selbsthilfe und Machtpolitik sich weder logisch noch kausal aus dem Zustand der Anarchie ergeben. Wenn das Staatensystem heute dennoch von diesen beiden Faktoren geprägt ist, so ist dies nicht strukturell, sondern prozessual bedingt: „Anarchy is what states make of it.“ (Wendt 1992, S.395) Wenn Identität und zentrale Interessen eines Staates also nicht von vornherein unverrückbar gegeben sind, wovon vor allem der Realismus ausgeht, dann lässt dies die Möglichkeit zu, dass diese als Variablen durch Interaktion verändert werden: „Constructivist optimists assume that what is, need not always be“. (Mercer 1995, S.229)
Von der Interaktion zwischen den Staaten hängt es ab, ob sich die soziale Identität der Akteure auf das Primat des Eigeninteresses beschränkt oder ob die Entwicklung eines kollektiven Interesses möglich ist. Die Chancen für Letzteres wachsen in dem Ausmaß, in dem sich Staaten mit dem Schicksal anderer Staaten identifizieren. (Wendt 1994, S.386) Eine solche positive Identifikation kann ein Gemeinschaftsgefühl, Solidarität und Loyalität hervorbringen und ein Handeln jenseits strenger Kosten-Nutzen-Rechnung zur Folge haben. Kooperation zwischen Staaten kann so zu einer ständigen gegenseitigen Beeinflussung hinsichtlich der Wahrnehmung der eigenen Identität führen. Normen, Identitäten und Interessen von Staaten sind grundlegende Variablen einer konstruktivistischen Analyse der internationalen Beziehungen.
Mit konstruktivistischen Ansätzen lässt sich also Kooperation – aber auch deren Nichtzustandekommen (Rother 2004) – analysieren und auf Politikfelder wie Migration herunterbrechen. Studien hierzu gibt es bislang aber kaum (für die EU etwa: Koslowski 2000; Sommer 2013), vielleicht auch weil etwa Wendt Staaten weiterhin als zentrale Akteure seiner Analyse verwendet und transnationale Phänomene wie Migration oder Zivilgesellschaft kaum berücksichtigt. Hier besteht noch erhebliches Potential zur Theorieentwicklung, zumal sich Konzepte wie die Herausbildung von kollektiven Identitäten durch Interaktion zwischen dem „Selbst“ und „den Anderen“ in vieler Weise mit Migration und Integration in Verbindung bringen ließen.
Die wohl engsten Verbindungspunkte zwischen konstruktivitischen Ansätzen und Migrationspolitik gibt es beim Konzept der „Versicherheitlichung“ („securitization“). Die Vertreter*innen der Kopenhagener Schule argumentieren, dass Sicherheit keine objektive Kategorie ist, sondern erst im Diskurs konstruiert wird. Die Versicherheitlichung von Migration ist hier eines der offenkundigsten Beispiele, wie sich etwa bei der Konstruktion von Grenzübertritten als Bedrohung (durch Aussagen wie „Die EU muss ihre Außengrenzen schützen“) zeigt (→ 12 Migrationspolitik der Europäischen Union).
2.2.5 Weitere politikwissenschaftliche Ansätze
Darüber hinaus gibt es viele weitere politikwissenschaftliche Ansätze, die zur Erklärung von Migration und Migrationspolitik herangezogen werden können. Bezeichnend ist dabei, dass sich die politikwissenschaftliche Auseinandersetzung mit Migration lange auf die Zielländer konzentrierte. Dies erklärte sich dadurch, dass seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts in steigendem Maße westeuropäische Demokratien zum Ziel von Migration wurden, was die dort ansässigen Politikwissenschaftler herausforderte, Antworten auf das zunehmend als „Krise” empfundene Phänomen zu geben. Die Auswirkungen von Migration auf die Herkunftsländer wurden entsprechend im deutlich geringeren Maße untersucht, sieht man einmal davon ab, dass man sich in der entwicklungspolitischen Forschung bereits seit längerem mit den (heimischen) Ursachen der Migration (Nuschler 2003) und dem Phänomen des Brain Drain beschäftigt hat (→ 10 Migration und Entwicklung).
Neben den Auswirkungen auf die nationale Sicherheit und die Außenpolitik (s.o.) untersuchen politikwissenschaftliche (wie auch soziologische, historische und rechtswissenschaftliche) Arbeiten insbesondere die innenpolitische Dimension von Migration. Im Mittelpunkt stehen die Gewährung von Bürgerrechten und mithin verfassungsrechtliche Fragen, der Einfluss auf die soziale Struktur des Gemeinwesens, vom Staat unternommene Integrationsanstrengungen und die Problematik der nationalen Identität (Bommes und Halfmann 1998; Oberndörfer 1991). Auch die Frage, warum trotz innenpolitischen Drucks Migration immer weiter zunehme, beschäftigte viele politikwissenschaftliche Arbeiten (sog „gap hypothesis“; Joppke 1998; Cornelius et al. 2004). Der eingangs erwähnte Hollifield erklärt dieses Phänomen mit seiner These des liberalen Paradoxons liberal state thesis (Hollifield und Wong 2015, S.240). Demnach ist der liberale Staat der Schlüssel, um Migration zu erklären: Eine radikale Restriktion von Migration durch den Staat impliziert die Verletzung von individuellen Rechten. Da der Schutz individueller Rechte zentrales Kriterium des liberalen Rechtsstaates ist, kann Migration nur begrenzt eingedämmt werden, auch wenn Migration den ökonomischen oder innenpolitischen Interessen widerspricht. Weiterhin fällt es liberalen Staaten schwer, einmal gewährte Rechte zu widerrufen. Liberal-institutionelle Ansätze sehen die Zunahme von Migration zudem an die wachsende Herausbildung von internationalen Menschenrechtsregimen und die damit verbundene Individualisierung des Völkerrechts gekoppelt (Jacobson 1996).
Aufgrund der fortschreitenden Integration der Europäischen Union hat sich die Politikwissenschaft zunehmend auch dem Bereich der Migrationspolitik auf der regionalen Ebene gewidmet. So geht etwa Christoph Roos (2013) der Frage nach, ob jüngere Entwicklungen der gemeinsamen EU-Immigrationspolitik zu Rissen in der vielbeschworenen „Festung Europa“ geführt haben. Das Forschungs-Puzzle besteht dabei in der Frage, warum Staaten gemeinsame Einwanderungsregelungen etablieren, die möglicherweise auch zu einer Zunahme von Einwanderung führen können, obwohl sie die Regelung des Zugangs zu ihrem Territorium als zentralen Ausdruck ihrer Souveränität verstehen. Dabei ist zwischen Grenz- und Einwanderungskontrolle zu unterscheiden: Während erstere im Schengenraum bereitwillig externalisert und eine einheitliche Grenz- und Visapolitik beschlossen wurde, liegt die weiter reichende Einwanderungspolitik weiterhin zum Großteil in der Hand der Nationalstaaten.
Читать дальше