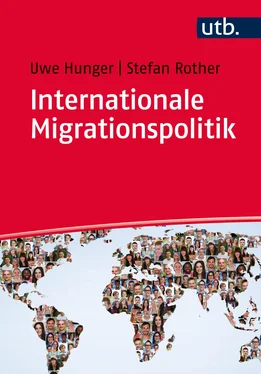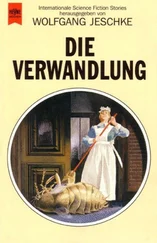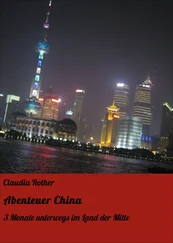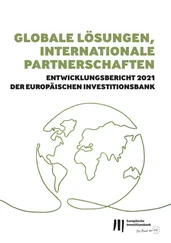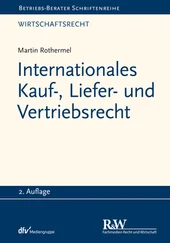Wie schon bei Ravenstein liegt der Fokus dieser Ansätze auf dem Individuum. Die Neue Ökonomie der Arbeitsmigration weist diesen engen Begründungszusammenhänge als zu einseitig und lückenhaft zurück und betont vielmehr, dass die Agierenden in der Migration nicht allein entscheidend seien, sondern auch Beziehungsnetzwerke eine Rolle spielen. Dabei werden Familien als wesentliche, kollektive Akteure der Migration betrachtet, weshalb der maßgebliche Bestimmungsgrund der Arbeitsmigration sich vor allem in der Diversifizierung des Familieneinkommens finden lässt (Stark 1984). Während klassische Theoreme wie das Push/Pull und andere neoklassische Theorien (u.a. Stadt-Land-Migration nach: Todaro 1969; Borjas 1989) stets die Lohndisparitäten und die individuelle Nutzenmaximierung als zentrale Motivatoren einer Migrationsentscheidung herausstellten, findet hier eine Einbindung der gesamten Familiensituation Eingang in die Gesamtbetrachtung (Stark 1984; 1991).
Gemäß dieser Überlegung wird z.B. in dem sog. „Household“-Ansatz die Entscheidung zur Migration nicht isoliert, sondern innerhalb eines Haushalts oder einer Familie betrachtet. Migration ist demnach eine kollektiv beschlossene, rationale Strategie, welche die innerhalb einer Familie vorhandenen Ressourcen zum Zwecke der Einkommenssteigerung einsetzt (Massey 1990). Auch kann die Migration zur Risikodiversifizierung eingesetzt werden, um das Risiko eines Einkommensausfalls in einem Haushalt zu senken. Migration ist demnach kein individueller Prozess, sondern das Resultat komplexer Gruppen- und Netzwerksstrukturen. Die Strategien können sich dabei im Laufe der Jahre durchaus wandeln: Wurden beispielsweise auf den Philippinen zunächst vorwiegend männliche Arbeiter ins Ausland gesandt, setzen zahlreiche Haushalte mittlerweile bevorzugt auf die Migration von weiblichen Angehörigen. Diese gelten als zuverlässiger und senden regelmäßigere und höhere Anteile ihres Einkommens an die Familien im Heimatland (Semyonov und Gorodzeisky 2004). Auch ist es möglich, dass durch die Migration anderer der eigene Wunsch ebenfalls zu migrieren, erst geweckt bzw. vergrößert wird. Da Migration oftmals mit einem Einkommenszuwachs verbunden ist, wächst auch bei anderen Familien der Wunsch, in den Genuss höherer Einkommen zu kommen, insbesondere dann, wenn sich die Menschen „im Verhältnis zur sozialen Referenzgruppe in ihrer Herkunftsregion“ (Pries 2010, S.15) benachteiligt sehen (relative Deprivation).
2.1.1 Theorien auf der Makroebene
So wichtig der Fokus auf die individuelle Ebene ist, so lässt sich auch argumentieren, dass diese Entscheidungen letztlich durch die Makroebene beeinflusst sind, etwa durch das kapitalistische Weltsystem, das den Druck zur Migration erst hervorruft. Strukturelle Ansätze haben in der Migrationsforschung daher ebenfalls eine große Tradition und großes Gewicht. Sie gehen zumeist auf (neo-)marxistische oder historisch-soziologische Theorien zurück. Dieses Bündel von Ansätzen lässt sich nicht eindeutig (nur) den Migrationstheorien zuordnen, so gibt es starke inhaltliche Überschneidungen mit den Bereichen Kapitalismus, Kolonialismus, Imperialismus und Neoliberalismus. Die Entstehung der strukturellen Theorien ist eng mit der in den 1970er und 1980er Jahren stattfindenden Arbeitsmigration aus ehemaligen Kolonien nach Nordamerika, Europa und Südafrika verbunden.
Politisch-ökonomische Ungleichheiten zwischen diesen Ländern bilden daher einen Analyseschwerpunkt in Bezug auf Migration. Im Gegensatz zu den Ansätzen der Mikroebene fokussieren strukturelle Ansätze, wie die Weltsystemtheorie oder Dependenztheorie, auf die Makroebene und beschäftigen sich mit den Rahmenbedingungen und Kontextfaktoren von Migration, wobei das Wirtschaftssystem eine zentrale Rolle einnimmt (Samers 2010, S.67; Smoliner et al. 2013, S.14). Im Folgenden werden einige strukturelle Ansätze vorgestellt, um ihre Unterschiede und Vielfalt herauszustellen.
Die Theorie der ‚Articulation of modes of production‘ geht auf das Konzept der Produktionsweise nach Marx zurück und beschreibt die unterschiedlich starke Einbindung in das kapitalistische System zwischen einzelnen Regionen bzw. Ländern. Die Entwicklung des Kapitalismus in Regionen mit vorkapitalistischen Strukturen hat einen zerstörerischen Effekt auf landwirtschaftliche und soziale Netzwerke gehabt (Portes und Walton 1981), sodass die Menschen in kapitalistische (Arbeits-)Strukturen gezwungen werden und schließlich in reichere Länder (zumeist in den Globalen Norden) emigrieren (Samers 2010, S.68f.).
Auf dieser Grundprämisse bauen auch neomarxistische Ansätze wie die sog. Weltsystemtheorie auf, zu deren Begründern Immanuel Wallerstein gehört. Diese Theorie geht von einem komplexen weltweiten System internationaler Arbeitsteilung und Machtstrukturen innerhalb des kapitalistischen Weltsystems aus (Wallerstein 2004). In diesem Weltsystem (das nicht zwangsläufig die gesamte Welt umfassen muss, aber in sich geschlossen ist) findet eine Umverteilung von Ressourcen von der Peripherie ins Zentrum statt. Während die früheren „Weltreiche“ nur ein Zentrum hatten, finden sich in der heutigen „Weltökonomie“ mehrere Machtzentren, die miteinander konkurrieren. Diese Machtzentren werden durch das zwischenstaatliche System in Balance gehalten, wobei Staaten zeitweise durchaus hegemoniale Führungsrollen einnehmen können. Zwischen Zentrum und Peripherie finden sich zudem oft autoritär regierte Staaten der „Semi-Peripherie“, die das System weiter stabilisieren.
Diesen Gedanken hatten bereits die sog. Dependenztheorien in den 1960er Jahren entwickelt und in vielen Studien aufgezeigt, wie sich die Abhängigkeiten (Dependenzen) der Länder in der sogenannten „Dritten Welt“ – heute spricht man eher vom „Globalen Süden“ – von den Industriestaaten des Nordens negativ auf ihre Entwicklung auswirken (für die deutsche Debatte siehe: Senghaas 1974). Wichtig im Kontext der Migrationsforschung ist, dass das Zentrum neben Rohstoffen und Profit aus Investitionen auch von billigen Arbeitskräften aus der Peripherie profitiert. Migrationsbewegungen ergeben sich demnach aus der Funktion der jeweiligen Länder im modernen kapitalistischen Weltsystem. Der „Brain Drain“ (→ 10 Migration und Entwicklung) aus Ländern der Peripherie und Semi-Peripherie ließe sich ebenso mit der Weltsystemtheorie erklären wie etwa die Nachfrage nach philippinischen Hausangestellten in Dubai oder Hongkong (→ 6 Migration und Gender). Kritisiert wird an diesen Theorieansätzen aber vor allem, dass sie dem Individuum kaum Entscheidungsfreiheit zugestehen.
Auf der anderen Seite des Spektrums spielen neo-liberalistische Ansätze im Kontext der Globalisierung eine wichtige Rolle, um die Zusammenhänge zwischen Migration und der Wirtschaftspolitik von Industrieländern, Unternehmen oder internationalen Organisationen (z.B. WTO, IMF) zu erklären. Der Neoliberalismus umspannt dabei verschiedene Politiken, Programme und Diskurse, die sich tendenziell deregulierend auf Arbeitsmärkte auswirken und staatliche Wohlfahrtsprogramme zugunsten einer wettbewerbsorientierten Logik beschränken. In reicheren Ländern werden häufig gezielt hochqualifizierte Immigrant*innen angeworben, um sich auf dem globalen Markt zu behaupten, wobei sich insbesondere die internationale Studierendenmobilität hervorheben lässt. Ärmere Länder erfahren ebenso eine (zum Teil unfreiwillige) strukturelle Anpassung, die durch voranschreitende Liberalisierungen, ausländische Direktinvestitionen und Handel noch verstärkt wird. Durch Rücküberweisungen der Migrant*innen partizipieren auch die Herkunftsorte der Migrant*innen am wirtschaftlichen Fortschritt in den Einwanderungsländern. Auch durch Rückwanderung oder zirkuläre Migration können positive Entwicklungsprozess in den Ausgangsräumen angestoßen werden (sog. Migration-Development-Nexus, Van Hear und Sorensen 2003).
Читать дальше