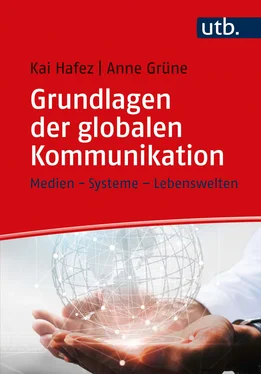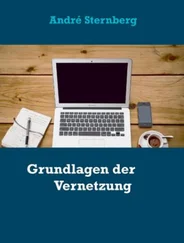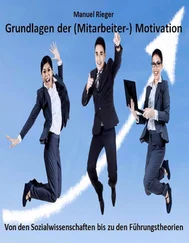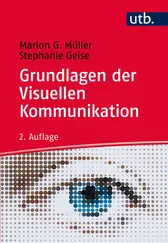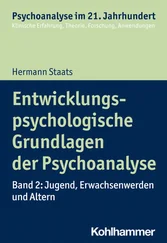Fazit: Dialog der „Kulturen“ in der erweiterten Lebenswelt
Unabhängig davon, ob man die quantitativen Methoden der früheren Forschung heute immer nachvollziehen kann (ist die Qualität mancher Interaktionen nicht bedeutsamer als die schiere Anzahl der Briefe, Telefonate und E-Mails?) oder ob man, wie in diesem Buch, Systemtheorie zur Handlungstheorie der Lebenswelt erweitern will (vgl. Kap. 1.2), weist die Schule der integrativen Systemtheoretiker dennoch den richtigen Weg. Dass das globale Integrationsdenken in der politologisch orientierten Sozialforschung entstanden ist, zeigt schon, dass weniger die Massenmedien, sondern vielmehr andere Sozialsysteme in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sowie Individuen und Gruppen in den Lebenswelten für Dialogverhältnisse verantwortlich sind. Gerade in der Annahme, soziale Kommunikation sei ebenso wichtig wie politischer und ökonomischer Austausch, liegt eine geradezu revolutionäre theoretische Deutung, die Kommunikation zur zentralen Ressource der sozialwissenschaftlichen Theoriebildung gleichrangig mit ökonomischen Verhältnissen und Herrschaftsbeziehungen macht.
Spätere kommunikationswissenschaftliche Forschungen wie die zum „Dialog der Kulturen“ oder zum „islamisch-westlichen Dialog“ konzentrieren sich wieder sehr viel mehr auf globale Medienkommunikation, Feindbilder und Images – Forschungsrichtungen, die ohne Zweifel gemäß der Flusser’schen Zweiteilung der Kommunikationsmodi in Diskurs und Dialog ihre Berechtigung haben, direkte Interaktionen aber eher am Rande berücksichtigen (Quandt/Gast 1998, Hafez 2003). Neuere Arbeiten der politischen Philosophie zur globalen Gemeinschaft benutzen zwar den Begriff des „Dialogs“ in einem interaktiven Sinn, ignorieren aber die kommunikationswissenschaftlichen Dimensionen des Problems (Linklater 1998, Etzioni 2004). Dass der „Dialog der Kulturen“ daher eine theoretisch nie recht zufriedenstellende Formel war, weil die ursprünglich bei Systemtheoretikern wie Deutsch angelegte Symbiose aus Gesellschafts- und Kommunikationsanalyse verloren gegangen ist, sei an dieser Stelle ausdrücklich festgehalten.
1.2 Kommunikationssysteme, Lebensweltwelten und deren Wandel
Systeme und Lebenswelten
Nach Etablierung eines kommunikationstheoretischen dualen Leitbildes einer sowohl beobachtenden Weltöffentlichkeit wie auch interaktiven globalen Gemeinschaft fragen wir nun, welche Akteure in den internationalen Beziehungen als Kommunikatoren in Frage kommen. Vor einem näheren Eingehen auf Akteurstypen sind allerdings einige metatheoretische Betrachtungen erforderlich, um Missverständnissen im Zuge der Theoriebildung vorzubeugen. James N. Rosenau hat es als Aufgabe der Globalisierungstheorie bezeichnet, Mikro- und Makrointeraktionen von Individuen beziehungsweise Staaten und Organisationen im Blick zu behalten (2007). Saskia Sassen geht sogar einen Schritt weiter und betrachtet überlappende und wechselwirkende Prozesse zwischen den Akteuren als entscheidend (2007). Nicht alle Theoretiker sind so offen für unterschiedliche Akteure, Systeme und die Vielfältigkeit der Wechselwirkungen zwischen ihnen. Beispielsweise existieren radikale Handlungstheorien wie die von Bruno Latour, der von der Prämisse ausgeht, das Globale sei immer lokal, da man, egal wo man sei, lokal agiere und selbst ferne Reisen sich als Summe lokaler Stationen abbilden ließen, deren Rekonstruktion er als Aufgabe seiner spezifischen Form der Akteur-Netzwerk-Theorie beschreibt (2014, vgl. a. Gerstenberger/Glasman 2016). Der Einfluss von Beobachtungssystemen wie den Massenmedien oder anderen Sozialsystemen als vermittelnden Instanzen des (vermeintlichen) Weltwissens, die unser Handeln prägen, tritt hier stark in den Hintergrund. Globale Kommunikation ist demnach reine Interaktion handelnder Individuen.
Solche Positionen erinnern an den alten Streit zwischen System- und Handlungstheoretikern, der in diesem Buch allerdings zugunsten einer integrativen Perspektive wie der von Rosenau oder Sassen aufgelöst werden soll, wo unterschiedliche System- und Akteurslogiken in Systemen und Lebenswelten berücksichtigt werden. Der oder die Einzelne wird von Systemen nie völlig beherrscht, auch wenn sein/ihr Leben Rollenübernahmen erfordert, die sein/ihr Leben strukturieren, die er/sie aber zugleich permanent bricht oder eigenständig interpretiert, formell wie auch informell. Systeme beeinflussen zudem die Lebenswelten des Menschen, werden aber auch von diesen beeinflusst oder aber beide Akteursräume bleiben unvernetzt. Die grundlegenden Konzepte der Sozialtheorie wie soziales Handeln/Interaktion, Normen, Rollen, Strukturen und Systeme sollen bei unserer Analyse mitgedacht werden (zur Einführung vgl. Bahrdt 1997). Letztlich ist hier Habermas‘ Dualismus von System und Lebenswelt von Bedeutung (Habermas 1995), wobei noch die Frage zu klären wäre, wer hier wen „kolonisiert“. Eine differenzierte Sichtweise auf Kommunikationsweisen von Systemen und Individuen (Kap. 1.3.) und deren Wechselwirkungen (Kap. 1.4.) ist aus unserer Sicht jedoch unbedingt erforderlich.
System-Lebenswelt-Netzwerk-Ansatz
Eine zweite Vorbemerkung ist notwendig: Der Systembegriff, der hier verwendet wird, ist kein streng funktionalistischer. Zwar führen wir selbstbewusst Kommunikationsprozesse als Momente der Theoriebildung ein. Wovon wir allerdings Abstand nehmen wollen, ist eine rein prozessorientierte Theoriebildung, die die Akteure als Kommunikatoren zu bloßen „Objekten“ abstrakter Abläufe wie „Vernetzungen“, „Konnektivitäten“ und „Kommunikationsflüssen“ macht. Die moderne Netzwerktheorie tendiert dazu, eine Akzentverschiebung von sozialen Akteuren zu Netzen vorzunehmen, wobei die interne Logik von Systemen (z.B. Organisationen, Unternehmen, aber auch psychischen Systemen von Individuen) oder Lebenswelten weniger beachtet werden als die zwischen den Systemen oder Lebenswelten bestehenden Netzwerke und Austauschbeziehungen. Die internen Strukturen kollabieren quasi unter dem Druck der Vernetzung. Dazu Jan van Dijk: „Traditional internal structures of organizations are crumbling and external structures of communication are added to them” (2012, S.33). Ähnlich äußert sich auch George Ritzer mit dem Hinweis auf die Prozesssoziologie von Norbert Elias: „[F]ollowing Elias, in thinking about globalization, it is important that we privilege process over structure (just as we have privileged flows over barriers)“ (2010, S.25).
In diesem Buch stehen zwar Kommunikationsprozesse im Vordergrund; Systeme und Lebenswelten bleiben aber kopräsent. Netzwerke sind Beziehungen innerhalb oder zwischen Sozialsystemen (Endruweit 2004, S.26), sie sind aber nicht die Sozialsysteme selbst, die deshalb mitgedacht werden müssen. Unsere Perspektive ist daher weder die der Akteur-Netzwerk-Theorie Latours noch die der Netzwerk-Theorie von Castells, sondern sie ist am ehesten als System-Lebenswelt-Netzwerk-Ansatz zu bezeichnen. Dieser Ansatz ähnelt der von Roger Silverstone eingeführten und von Nick Couldry an der London School of Economics and Political Science (LSE) weitergeführten Sicht. Die Netzwerkmetapher wird dort als theoretisch zu anspruchslos für die Sozialtheorie angesehen, da sie die von den Handelnden erzeugten Interpretationen der Netzwerke unberücksichtigt lässt (Couldry 2006, S.104). Couldry spricht hier zu Recht von einem „problematischen Funktionalismus“, „so zu tun, als ob Medien das Soziale und die natürlichen Kanäle des sozialen Lebens und sozialer Auseinandersetzung wären, anstatt hoch spezifische und institutionell fokussierte Mittel der Repräsentation des sozialen Lebens“ (ebenda, S.104). Er wendet sich gegen den „Mythos des mediatisierten Zentrums“ und kritisiert die Tendenz der Kommunikationswissenschaft, Medien mit Gesellschaft gleichzusetzen (ebenda, S.105). Auch der deutsche Kommunikationstheoretiker Manfred Rühl äußert sich ähnlich: „Globale Kommunikationssysteme sind eingebettet in psychische, organische, chemische, physikalische, kurz: in nicht-kommunikative Mitwelten, die […] bei der Verwirklichung von Kommunikation mitwirken, ohne dazuzugehören. Kommunikationssysteme sind von der Mitwelt klar abzugrenzen, aber nicht zu trennen“ (ebenda, S.362).
Читать дальше