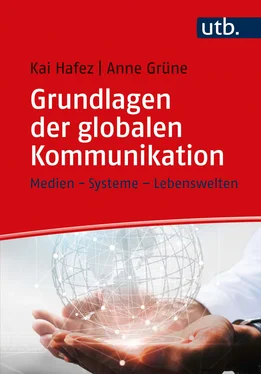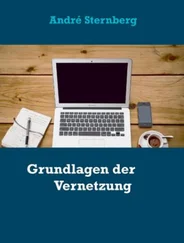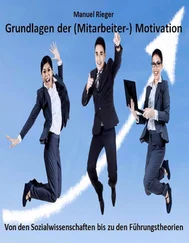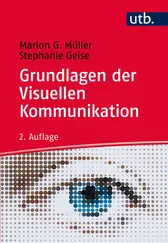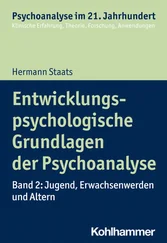1 ...7 8 9 11 12 13 ...29 Globale Lebenswelten: ein Desideratum der „interkulturellen Kommunikation“
Zu den skizzierten systemischen Akteuren kommen nun Akteure und komplexe Kommunikationsprozesse in Lebenswelten hinzu. Auch Individuen und Kleingruppen beobachten und interagieren grenzüberschreitend, und zwar selbst dann, wenn sie dies nicht im Kontext bestimmter Gemeinschaften oder Organisationen, sondern informell, dafür aber in einem „realen“ Raum tun. Der Begriff der Gemeinschaft wird daher um den der Kleingruppe ergänzt, da hier die persönlichen Kontakte der Gruppenmitglieder zwingend notwendig sind und nicht – wie bei der Großgemeinschaft – identifikatorische und imaginierte, selbst oder fremd gewählte Zuordnungen über die Mitgliedschaft entscheiden. In der Lebenswelt der Menschen ist dort, wo man vom „gesellschaftlichen Leben“ spricht, das Aufeinandertreffen in nicht-gemeinschaftlichen Gruppen sogar eher die Regel (im Kino, auf der Straße, im Supermarkt usw.). Eine klare Trennung zwischen Großgemeinschaften und gemeinschaftlichen oder nicht-gemeinschaftlichen Kleingruppen ist insofern möglich, als Großgemeinschaften, abgesehen von Sondersituationen wie Netzgemeinschaften oder bestimmten Formen der Versammlungskommunikation, keine interaktiven Gemeinschaften sein können, was bei Kleingruppen aber generell der Fall ist.
In Hinblick auf die lebensweltlichen Kontexte individueller, gruppen- oder gemeinschaftsförmiger Kommunikation gilt es nun, die Frage zu beantworten, ob es zu einer Verschiebung von nationalen/lokalen hin zu globalen, also inter- oder transnationalen, Lebenswelten kommt? Eine notwendige Voraussetzung für die Entstehung „globaler Lebenswelten“ ist im bisherigen Argumentationszusammenhang nicht nur die individuelle Beobachtung der Welt, etwa durch die Angebote der Medien, sondern ebenso das Vorhandensein unterschiedlicher „interkultureller Kommunikationssituationen“ in sozialen Alltagswelten.
Das für diese Antwort prädestinierte Forschungsfeld der „interkulturellen Kommunikation“ liefert allerdings angesichts konzeptueller Uneinigkeiten bisher keine ausreichend belastbaren Erkenntnisse. Denn bis heute hält sich hier die Idee des Einzelnen als Träger einer bestimmten, objektivierten „Kultur“ als verbreitetes Paradigma (u.a. Maletzke 1996, Hofstede et al. 2010). Dieses ist allerdings hochgradig problematisch, da es dem Individuum keinen Raum für eigenständige Kommunikationsleistungen zugesteht und essenzialistische Kulturraumvorstellungen bedient, wonach Individuen einer nationalen oder gar supranationalen Gesellschaftsordnung identische Sets an Weltdeutungen aufweisen und sich in ihren Handlungsmustern kaum unterscheiden würden. Zwar teilen Individuen in Gruppen und Gemeinschaften bestimmte handlungsprägende lokale Erfahrungszusammenhänge und sie können durch die gemeinsame Beobachtung von nationalen Mediendiskursen durchaus koorientiert sein. Aus der bloßen Lokalisierung von Menschen in bestimmten Weltregionen aber grundsätzlich differente, national geprägte Kommunikationsformen abzuleiten, ist empirisch wie theoretisch angesichts der Diversität menschlicher Daseinsformen nicht haltbar und im Sinne der zuvor diskutierten integrationistischen Überlegungen sogar politisch gefährlich, wenn nämlich indirekt eine problemorientierte Perspektive grenzüberschreitender Verständigung eingenommen und per se von zum Teil unüberbrückbaren Differenzen ausgegangen wird, die Kommunikation erschweren (Hansen 2011, S.179ff., S.251ff., vgl. a. Kapitel 7.2.1). In der globalen Interaktion steht ja nicht prinzipiell in Frage, dass Individuen mit unterschiedlichen kulturellen, sozialen und geolinguistischen Sozialisationserfahrungen Differenzen überwinden können, sondern vielmehr unter welchen Bedingungen, in welcher Form und mit welchen möglichen Wandlungserscheinungen dies in der grenzüberschreitenden Alltagskommunikation geschieht.
Doch auch wenn das Konzept des „Kulturellen“ Anlass für Missverständnisse bietet, soll und kann es nicht ganz aufgegeben werden. So werden kulturelle Prägungen auch an vielen Stellen dieses Buches behandelt, etwa wenn es um stereotype Medienbilder, Public Diplomacy oder das Zusammenspiel von globaler Interaktion, Medien und Vorurteilen gegenüber Gruppen geht. Allerdings wird „Kultur“ nicht in einer vom Akteur oder von der kommunikativen Konstruktion von Kultur losgelösten Art und Weise, sondern im Sinne unseres System-Lebenswelt-Netzwerk-Ansatzes untersucht. Unser Verständnis von Kultur folgt eher dem der Cultural Studies und meint konkrete Problematiken der Bedeutungszuweisung und symbolischen Klassifikationssysteme sowie deren alltägliche Aneignung, Produktion wie auch Dekonstruktion durch spezifische gesellschaftliche Akteure (Hall 1980). Diese Akteure sind im Zusammenhang globaler Kommunikationsbeziehungen in der Alltagswelt allerdings neu zu bewerten. Denn es wird darum gehen, Individuen mit oder ohne globale Kommunikationserfahrungen zu unterscheiden. Diese Erfahrungen können wiederum gemäß der eingeführten Systematik von Kommunikationsmodi vielfach variieren und dementsprechend unterschiedliche Konsequenzen für die Wandlungsprozesse lokaler Lebenswelten bedeuten.
Glokalisierung und Hybridisierung des Alltagshandelns
Im Bereich der Kulturtheorie ist die kulturelle Wandlungsdynamik der Globalisierung, komplementär zum Systemwandel, als „Glokalisierung“ oder „Hybridisierung“ beschrieben worden (u.a. Robertson 1995, Nederveen Pieterse 1994, 1998, García Canclini 2005, Appadurai 1998, Hall 1992, Kraidy 2005). Wenngleich die Autoren unterschiedliche Perspektiven der Soziologie, Anthropologie oder der Cultural Studies einnehmen und in ihren Argumentationsgängen variieren, ist ihnen doch gemeinsam, dass sie auf die grundsätzliche Heterogenität kultureller Wandlungsprozesse unter dem Einfluss globaler Entwicklungen verweisen. Wenn Menschen, Ideen, Symbole und Güter heute immer leichter global zirkulieren können, folgt daraus keine eindimensionale Wandlungslogik der kulturellen Angleichung (Homogenisierung) oder Rückbesinnung auf kulturelle Traditionsbestände (Heterogenisierung). Vielmehr ist zu beobachten, dass diese Prozesse gleichzeitig ablaufen können.
Statt der Frage von Übernahme oder Ablehnung kultureller Praktiken entstehen häufig Mischformen, indem sich kulturelle Akteure Teile globaler Angebote zu eigen machen und in kreativer Eigenständigkeit neue Varianten entwickeln. Diskutiert wurden diese hybriden Praktiken vor allem am Beispiel des lokalen Umgangs mit globaler Populärkultur. In der Tradition der Cultural Studies stellt sich dabei insbesondere die Frage nach machtabhängigen Handlungsmöglichkeiten, also danach, wie frei lokale Individuen tatsächlich in ihrer Aneignung globaler Angebote sind – etwa vor dem Hintergrund postkolonialer Machtverhältnisse, die Einfluss auf Umfang und Richtung der Weiterverbreitung haben können oder in Zusammenhang mit der Abhängigkeit von lokalen wie globalen hegemonialen Deutungsmustern, die über die Art und Weise von Repräsentation und damit auch über die Möglichkeiten der individuellen Auseinandersetzung und Positionierung entscheiden können.
Die Forschung zur kulturellen Globalisierung zielt damit zwar bereits klar auf die Alltagswelt von Individuen, sie erklärt aber deren Kommunikationsprozesse noch nicht systematisch. Die Aneignung globaler Medienangebote beschreibt nur eine, nämlich indirekte beziehungsweise mittelbare Form der grenzüberschreitenden Beobachtung. Auch wenn wir uns mitunter von globalen Trends in unserem Alltagshandeln beeinflussen lassen, so führt dies im besten Fall zu einer Synchronisierung von Lebensstilen, nicht aber zu grenzüberschreitenden Dialogen. Mediale Berichterstattung über ferne Welten, weltweit ähnlich formatierte Unterhaltungsangebote oder globale Popkultur liefern uns nur erste Ansatzpunkte für ein selektives Wissen über die Welt. Daneben können Individuen in ihrer Lebenswelt etwa auf privaten oder beruflichen Reisen oder in multikulturellen Kontexten moderner Gesellschaften global interagieren. Die Gestaltung dieser Kommunikationssituationen ist wiederum abhängig davon, ob Individuen diese Erfahrungen alleine machen oder in Gruppen, beispielsweise mit der Familie, Freunden oder Kollegen, in welchen Gemeinschaftszusammenhang das Erfahrungswissen eingebettet wird und in welcher Nachhaltigkeit globale Kontakte weiterbestehen. So ist es ein Unterschied, ob das globale Wissen als Expertenwissen in der Berufsrolle des Einzelnen verbleibt oder zum Verhandlungsgegenstand einer lokalen Gemeinschaft wird. Entscheidend sind also nicht nur die Rollenmuster und Rahmenbedingungen globaler Interaktionen von Einzelnen, sondern auch lokale Weiterverarbeitungen globalen Wissens, das aus unterschiedlichen Kontaktsituationen entsteht und eher expliziten (z.B. Faktenkenntnis) oder impliziten Charakter (Erfahrungswissen) haben kann.
Читать дальше