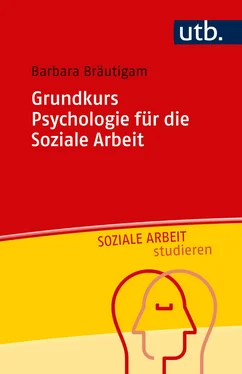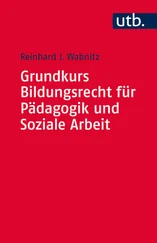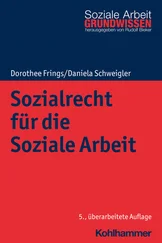1.1 Frühe Vorstellungen
Psychologie ist ein griechischer Begriff und bedeutet wörtlich übersetzt die „Lehre von der Seele“. Erste wesentliche Überlegungen zur Beschaffenheit der Seele stammen aus der Antike und aus der griechischen Philosophie. In der Antike beschäftigte sich die Medizin mit der Körperheilkunde und die Philosophie mit der Seelenheilkunde. Bereits im 6. Jahrhundert v. Chr. entwarf die Bewegung der Orphiker eine Lehre der Seele, die auf einem Dualismus von Körper und Seele basierte, bei dem der Körper im Diesseits verhaftet und das Gefängnis der Seele darstelle (Schönpflug 2013). Sie stützten sich dabei auf den – mittlerweile vielfach variierten – Mythos von Orpheus und Eurydike. Dem Mythos zufolge versucht Orpheus seine geliebte verstorbene Frau Eurydike aus der Totenwelt und dem Jenseits zurückzuholen und scheitert, weil er die Bedingung der Götter, sich nach seiner Frau nicht umzusehen, nicht erfüllen kann. Bis heute symbolisiert dieser Mythos die Sehnsucht nach Unsterblichkeit.
Platon (428–348 v. Chr.) vertrat ebenfalls die Auffassung, dass Körper erst dann leben, wenn sie beseelt seien. Er verglich die Seele mit einem Gespann, das von einem Rappen und einem Schimmel gezogen würde; der Rappe verkörpere die Begierde und ziehe den Wagen in Richtung der materiellen Welt, während der Schimmel nach etwas Höherem strebe. Der Wagenlenker habe Kraft seiner Vernunft die Aufgabe, dieses Gespann durch die Welt zu steuern. Die Parallelen zu Sigmund Freuds Strukturmodell, bei dem das Ich zwischen dem Es, das für die Triebe und Begierden steht und dem Über-Ich, das die Moral verkörpert, vermitteln muss, sind mehr als deutlich. Bereits in Platons Seeelenmodell sind die Wurzeln für moderne psychologische Theorien verankert (Walach 2013, 106 f.).
Andere aus der Zeit der Antike übermittelte Überlegungen über die Beschaffenheit der Seele trugen eher den Charakter von Typologien:
„Eine rein äußerliche Typologie hat etwa Hippokrates (ca. 460–370 v. Chr.) vorgestellt. Er unterteilte die Menschen in schlanke, asthenische auf der einen Seite und in dicke, pyknische Typen auf der anderen Seite. Seine Anhänger, die Hippokraten, haben dem eine innere Typologie hinzugefügt, die nichts anderes war als eine Safttheorie. Safttheorien gehen davon aus, dass im Körper vier verschiedene Säfte (Blut, schwarze und gelbe Galle, sowie Phlegma) zirkulieren und immer dann, wenn das Verhältnis der Säfte nicht perfekt ausbalanciert ist, etwas schiefgehen kann. Derjenige der Säfte, der überwiegt, kann den Charakter des Menschen dominieren“ (Hecht/Desnizza 2012, 104).
Laut diesen Theorien stehen die vier Säfte für jeweils ein Element und für ein Temperament. Die schwarze Galle (Wasser) deute, so die Annahme, auf ein überwiegend melancholisches und schwermütiges, die gelbe Galle (Luft) auf ein cholerisches, aufbrausendes, das Blut (Feuer) auf ein wechsel- und launenhaftes und das Phlegma (Erde) auf ein träges Temperament hin. Die Lehre von den Säften kann zwar getrost als überholt betrachtet werden. Die Existenz unterschiedlicher und von Geburt an bestehender Temperamente hingegen ist bis heute unbestritten (s. Kapitel 2.3.3).
Zwei weitere philosophische Strömungen der Antike, die sich mit dem Wesen der Seele auseinandersetzten, sind die Stoiker und die Epikureer. Die Stoiker stellten die Selbstkontrolle in den Mittelpunkt. Gefühle und Begierden sind ihnen zufolge schädlich, die Seele müsse vor emotionaler und triebhafter Erregung bewahrt werden. Epikur (341–271 v. Chr.) hingegen propagierte, dass Lust und Sinnesempfindungen in Maßen durchaus wichtig für das seelische Wohlbefinden seien (Schönpflug 2013).
Platons Schüler Aristoteles (384–322 v. Chr.) entwickelte eine monistische Seelenlehre, d.h., er ging nicht mehr von einer grundsätzlichen Zweiteilung zwischen Körper und Seele aus. Er differenzierte vielmehr zwischen der vegetativen Seele, die alle Organismen besäßen, der animalischen Seele, die Tiere und Menschen hätten und für die Begierden, Empfindungen und die Fortbewegung zuständig sei, und zum dritten zwischen der dem Menschen eigenen Geistesseele, die die Fähigkeit zur Logik bedeute. Im späteren Mittelalter griff Thomas von Aquin (1225–1274) die aristotelische Seelenlehre wieder auf und verband sie mit dem frühmittelalterlichen Seelenbegriff von Augustinus (354–430 n. Chr.). Augustinus betrachtete die Seele unter einem metaphysischen und nach dem Himmlischen strebenden Aspekt und
„…unter einem empirischen Aspekt des Selbst, weil es sich in seiner eigenen Erfahrung widerspiegelt. Jene in der Selbsterfahrung sich spiegelnde Seele ordnete Augustinus […] dem Diesseits zu“ (Schönpflug 2013, 77).
Insofern kann man also Augustinus als einen der ersten Denker bezeichnen, der die Bedeutung von Selbsterfahrung und Nachdenken über sich selbst erkannte. Im Mittelalter hat sich die Seelenkunde zwar ansonsten nur wenig entwickelt (Hecht/Desnizza 2012, 109); mit Beginn der Reformation und dem zunehmenden Interesse am Verstehen des Menschen avancierte die Seelenkunde aber schließlich zu einem eigenen Forschungsgebiet.
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Auseinandersetzung mit der Beschaffenheit der menschlichen Seele zunächst den Philosophen vorbehalten blieb und sich vieles um die Frage rankte, aus welchen Teilen die Seele denn bestehe und ob sie getrennt vom Körper existiere.
1.2 Unterschiedliche Wege zum Erkenntnisgewinn
Mit dem Interesse für den Menschen geht auch die Neugier einher, wie dieser eigentlich wahrnehmen bzw. überhaupt Erfahrungen machen und diese einordnen könne. Theorien hierüber werden als „Erkenntnistheorien“ bezeichnet. Bis heute existieren in der Psychologie, aber auch in der Sozialen Arbeit, sehr unterschiedliche forscherische Zugänge und Annahmen, wie und vor allem wie voraussetzungsfrei neue wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen werden können. Daher werden im Folgenden drei zentrale Strömungen, die für das Verständnis der psychologischen Perspektive wichtig sind, erläutert.
Nach der empiristischen Erkenntnistheorie von John Locke (1632–1704)basiert die menschliche Erkenntnis ausschließlich auf sinnlichen Erfahrungen. Locke zufolge gibt es keine angeborenen Ideen; der Zuwachs an Erkenntnis ergibt sich aus der Reflexion der Erfahrungen, aus der dann wiederum neue Erkenntnisse gewonnen werden können. Der Empirismus geht also davon aus, dass es keine allgemeingültigen Gesetze gibt und dass der Mensch rein auf Grund seiner Erfahrungen so geworden ist, wie er ist.
Im Gegensatz dazu geht der Rationalismus davon aus, dass Vernunft für den Erkenntnisprozess eine wesentliche Voraussetzung ist. Als Begründer der rationalistischen Erkenntnistheorie gilt René Descartes (1596–1649).
„Rationalisten setzen auf die Vernunft als Erkenntnisquelle. Dementsprechend fordert Descartes (1972), die Erkenntniskraft sei darauf auszurichten, „dass sie über alles, was vorkommt, unerschütterliche und wahre Urteile herausbringt“ (S. 3). Die Regel verlangt, dass wir an allem zweifeln, was uns für gewöhnlich verlässlich scheint, nämlich unsere Sinne, unser Körper, unser Gedächtnis, unsere Sprache etc. Der Zweifel findet ein Ende, wenn uns dank der Vernunft bewusst wird, dass wir zwar alles bezweifeln können, nicht aber die Tatsache, dass wir zweifeln. Im Vollzug des Zweifels gibt es eine Evidenz, die uns als unbezweifelbar wahr erscheint“ (Herzog 2012, 49).
Zentrale Punkte an Descartes Theorie sind also sein genereller Zweifel an der Möglichkeit wahrer Erkenntnis und seine strikte Trennung zwischen Geist und Materie. Immanuel Kant (1724–1804) wies in seinem Werk „Kritik der reinen Vernunft“ daraufhin, dass Erkenntnisse zwar sehr wohl empirisch gewonnen werden, es aber „apriorische Vorbedingungen“ von Erfahrungen gäbe. Vor aller Erfahrung müssen also bereits geistige Strukturen vorhanden sein, um Erfahrungen überhaupt machen bzw. verarbeiten zu können (Walach 2013, 181f.).
Читать дальше