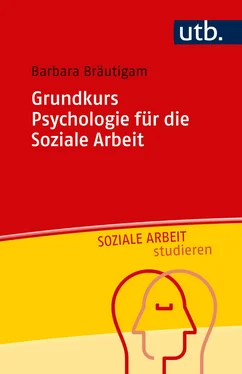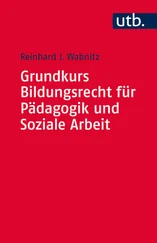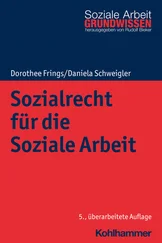Störungen können somit auch als „kompetente Lösungsversuche“ (Marvin 2003) angesehen werden, um sehr ungünstige Umweltbedingungen individuell zu kompensieren. Bei Lisa kann ihre soziale Zurückgezogenheit z.B. als Versuch angesehen werden, sich selbst am besten zu schützen; auch diese Komponente sollte bei der Auswahl möglicher Hilfen berücksichtigt werden.
Der zweite Grund, warum entwicklungspsychologische Kenntnisse für Fachkräfte der Sozialen Arbeit wichtig sind, besteht in der Fähigkeit zur Differenzierung zwischen entwicklungsangemessenen bzw. erwartbaren Verhaltensweisen und überfordernden bzw. unterfordernden Ansprüchen an die jeweiligen Menschen. Die Erwartung von Eltern, dass ihr drei Monate altes Kind durchschläft, ist zwar ausgesprochen verständlich, aber aus entwicklungspsychologischer Perspektive nicht angemessen. Gleichzeitig kann einem 12-jährigen Kind in der Regel zugemutet werden, allein zur Schule zu gehen und nicht von seinen Eltern ständig begleitet zu werden. Entwicklungspsychologie bietet somit eine normative Orientierungsfolie, auch wenn diese, wie in Lisas Fall, durchaus kritisch zu hinterfragen ist. Auf Grund von Lisas biologischer Vorgeschichte ist z.B. nicht zu erwarten, dass sie mit vier Jahren bereits in allen „Funktionsbereichen“ altersentsprechend entwickelt ist.
2.2 Der Entwicklungsbegriff und Entwicklungsmodelle
„Es kann schon nicht alles so bleiben
Hier unter dem wechselnden Mond
Es blüht eine Zeit und verwelket
Was mit uns die Erde bewohnt […]“ (August von Kotzebue, 1802).
Vereinfacht könnte man sagen, dass Entwicklung Veränderung über die Zeit bedeutet. Die meisten EntwicklungspsychologInnen gehen allerdings davon aus, dass es sich dabei um Veränderungen handelt, die lebensalterbezogen, langfristig und geordnet verlaufen (Ulich 2005). Nach dieser Auffassung wäre also eine kurzfristige Veränderung des Gemütszustandes, wie z.B. eine depressive Episode, keine Entwicklung. Hingegen ist eine fortschreitende Erkrankung im höheren Lebensalter, wie z.B. Demenz, durchaus als Entwicklung zu verstehen.
Ein erweiterter Entwicklungsbegriff beinhaltet alle längerfristig wirksamen Veränderungen von Kompetenzen, also alle bleibenden sowie kurzzeitigen Veränderungen, die weitere Veränderungen nach sich ziehen (Flammer/Alsaker 2002).
Es gibt sehr unterschiedliche Vorstellungen und Ideen davon, wie Entwicklung von statten geht. Dies wird beispielhaft deutlich an unterschiedlichen Vorstellungen von Kindheit und des angemessenen Umgangs mit Kindern (Ariès 1975; deMause 1989; Dornes 2012). Philipp Ariès zeichnet in seinem berühmten Buch „Geschichte der Kindheit“ (1975) den Wandel des Kindheitsbegriffs nach und macht die Relativität und die historische Eingebundenheit des Begriffs der Kindheit, so wie wir ihn heute verstehen, deutlich. Nach dem Historiker Lloyd deMause (1989) ist das Verständnis von Kindheit und den Bedürfnissen von Kindern bis ins 20. Jahrhundert zum einen als eine Art Abnahme eines Alptraums zu verstehen. Dieser reichte von systematischen Kindermorden in der Antike (Herodes) über die in manchen Ländern bis heute bestehende gnadenlose Ausbeutung von Kindern als Arbeitskraft bis hin zur gesetzlichen Ächtung von Gewalt in der Erziehung in Deutschland im Jahre 2000 der Erziehung. Zum anderen weist Martin Dornes (2012) darauf hin, dass Kinder zwar zum einen kontinuierlich mehr Rechte erhielten, aber dafür umso mehr an Freiheiten einbüßten.
Im 17. und 18. Jahrhundert herrschte die Vorstellung vor, dass das Kind ein kleiner Erwachsener sei und keiner spezifischen Lebensräume bedürfe. Eine andere Idee, die vor allem in der christlichen Religion wurzelte, implizierte, dass Kinder eher einen schlechten Kern haben und vor allem bestraft werden müssen – hier spricht man von dem sogenannten „Erbsündemodell“. Jean Jacques Rosseau, einer der wichtigsten Philosophen und Pädagogen der Aufklärung (1712–1778), vertrat hingegen die Auffassung, dass der Mensch und somit auch das Kind von Natur aus gut sei, und im Wesentlichen vor äußeren und somit auch vor erzieherischen Einflüssen geschützt werden müsse. Heute herrscht in der westlichen Welt in der Regel das Bild vom Kind als einer aktiv handelnden Persönlichkeit, das in seiner Kompetenzentwicklung umfassend gefördert und begleitet werden sollte (Hédervári-Heller 2011).
Eine Kernfrage aller Entwicklungsmodelle beschäftigte sich damit, ob die Entwicklung von inneren oder äußeren Kräften gelenkt wird. Auch in der Sozialen Arbeit ist diese Frage immer dann von Bedeutsamkeit, wenn es um die Möglichkeiten von äußerer Einflussnahme bzw. Hilfe und Unterstützung von verschiedenen Zielgruppen geht. Historisch bedeutsam sind dabei zwei entgegengesetzte Modelle: das endogenistische und das exogenistische Entwicklungsmodell. Beide Modelle wurden Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts vertreten und prägten die damaligen Vorstellungen von Entwicklungspsychologie.
Das endogenistische Entwicklungsmodell stellte Entwicklung phasenhaft in mehreren irreversiblen Schritten ablaufend dar, an deren Ende ein abgeschlossener Reifezustand vorlag. Die einzelnen Phasen wurden im Kindesalter bildhaft benannt – der Greifling, der Läufling, das Schimpansenalter, das Alter der Namensfragen/ Warumfragen, das Märchenalter, die Schulreife. Teile dieser mittlerweile in seiner Absolutheit überholten Vorstellung finden sich nach wie vor in verschiedenen pädagogischen Konzepten, so z.B. in der Waldorfpädagogik oder auch übergreifend in der Feststellung der Schulreife.
Das exogenistische, auch als Tabula-Rasa-Modell bezeichnete Modell, findet seine Wurzeln vor allem im Behaviourismus (s. Kapitel 3.6.2 und 6.5). Es geht davon aus, dass Kinder ohne jegliche Anlagen auf die Welt kommen und durch Erziehung in jede beliebige Richtung geformt werden können. Nach dieser Vorstellung gibt es keine festgelegten Abläufe, sondern Entwicklung wird als Lernfortschritt betrachtet – Dinge können beliebig gelernt oder auch wieder verlernt werden. Auch dieses Modell ist mittlerweile in seinem Absolutheitsanspruch überholt (Wicki 2015). Teile davon finden sich aber noch immer in eher verhaltensorientierten Konzepten von Heimeinrichtungen oder Jugendwohngruppen, die vor allem mit Lob und Strafe in sogenannten Verstärkerprogrammen (s. Kapitel 3.6.3) arbeiten.
Insgesamt werden beide Entwicklungsmodelle – das endogenistische und das exogenistische – mittlerweile als zu universalistisch beurteilt, weil sie z.B. zu wenig kulturelle und individuelle Unterschiede berücksichtigen. Zudem konzentrierten sich beide Entwicklungsmodelle sehr auf die Kindheit und Jugend und beinhalten tendenziell starre und normative Vorstellungen von Entwicklungsverläufen (Montada et al. 2012).
Die moderne Entwicklungspsychologie betrachtet Entwicklung über die gesamte Lebensspanne und bezieht differentielle Entwicklungen ein. Zudem wird Entwicklung in viel stärkerem Maße kontextabhängig und als von den sozialen Versorgungssystemen abhängig verstanden. So weiß man beispielsweise, dass Armut ein wesentliches Entwicklungsrisiko darstellt (Weiß 2010).
„Die Entwicklungspsychologie der Lebensspanne hat eine Erkenntnis in aller Schärfe deutlich gemacht: Die differenziellen Unterschiede im Lebenslauf beziehen sich nicht nur auf die Variabilität zwischen Kulturen, Subkulturen oder sozialen Gruppen, sondern auch auf die Unterschiede zwischen unterschiedlichen Generationen. Sexualität beispielsweise ist heutzutage von einem Jugendlichen in anderer Weise zu bewältigen als früher, ebenso wie etwa das Altern heute andere Anforderungen an die Menschen stellt als an Angehörige früherer Generationen. Von Generation zu Generation sind nur beschränkte Schlussfolgerungen möglich. So wird Entwicklungspsychologie auch immer eine ‚unendliche Geschichte‘ sein“ (Langfeldt/Nothdurft 2015, 73).
Читать дальше