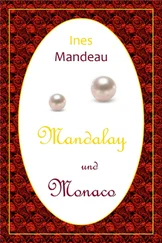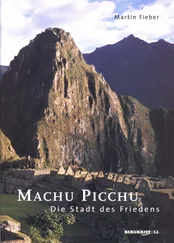das Prinzip der Einhaltung universaler Normen (um „an ihnen die Legitimität der eigenen Interessen und Handlungsweisen sowie die zur Problembearbeitung eingesetzten ideologischen, militärischen, ökonomischen und politischen Machtquellen [zu prüfen]“) sowie
das Prinzip der Reflexivität (wonach das Eingestehen des eigenen Scheiterns nicht wie beim sicherheitslogischen Denken als Schwäche gilt, sondern als „eine Fähigkeit, die zu verbesserten Resultaten führen kann“).
Bei Frieden und Sicherheit handelt es sich – das haben die obigen Ausführungen aufzeigen können – um durchaus differente Begriffe. Insbesondere verweisen sie auf unterschiedlich eingenommene Perspektiven. Dabei lässt sich die Debatte um eine Friedens- und Sicherheitslogik auf einen zentralen Punkt bringen:
„[D]ie Sicherheitslogik mit ihrer auf Abgrenzung zielenden Orientierung befördert Sicherheit gegen einen anderen, die Friedenslogik weist dem Gegenüber dagegen eine zentrale Rolle als mitverantwortlichem Partner für die Qualität der Beziehung zu“ (Nielebock 2016, S.10).
Was folgt nun aber aus dieser begrifflichen Differenz von Frieden und Sicherheit? Hanne-Margret Birckenbach (2012, S.42; Hervorh. d. Verf.) spricht von einer „Friedenslogik statt Sicherheitslogik“ und räumt damit dem Frieden den sachlichen Vorrang ein. Und auch für Sabine Jaberg (2017a, S.43) „gebührt aus ethischer Perspektive dem Frieden der Vorzug“. Beide Friedensforscherinnen setzen auf einen Perspektivenwechsel und die konsequente Einlösung einer Friedenspolitik. Dagegen plädieren Christopher Daase und Bernhard Moltmann (1991, S.35) für ein „integriertes Verständnis von Friedens- und Sicherheitspolitik“:
„Auch wenn dem Frieden der sachliche Vorrang einzuräumen ist, muß die Sicherheitspolitik auf ihrem temporären Vorrang bestehen, denn Friedenspolitik ohne den realistischen Blick auf die internationale Lage wird am nationalen und innergesellschaftlichen Sicherheitsbedürfnis scheitern. Sicherheitspolitik aber ohne das Korrektiv des Friedens ist nicht friedensfähig.“
Beide Auffassungen müssen nicht in Widerspruch zueinander treten, lässt sich ein integratives Verständnis von Frieden und Sicherheit durch eine Konvergenz beider Begriffe erreichen (vgl. Jaberg 2017a, S.47ff.), auch wenn diese nicht völlig zur Deckung gebracht werden können. Konzepte wie beispielsweise die auf die Palme-Kommission von 1982 zurückgehende Gemeinsame Sicherheit verweisen – und das zeigt sich bereits am Begriff der Gemeinsamen Sicherheit selbst – auf Möglichkeiten einer friedensfähigen Sicherheitspolitik. Ein solches Konzept ist voraussetzungsreich und zielt, verbunden mit der Annahme, dass Sicherheit nicht voreinander, nur miteinander zu suchen ist, auf eine konsequente Abkehr jeglicher Abschreckungspolitik (vgl. Kapitel 11.4; auch Werkner 2019a).
Weiterführende Literatur:
Gießmann, Hans J. 2011. Frieden und Sicherheit. In Handbuch Frieden , hrsg. von Hans J. Gießmann und Bernhard Rinke, 541-556. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Dieser Beitrag gibt einen guten Überblick über die begrifflichen Parallelen und Divergenzen der beiden Begriffe Frieden und Sicherheit.
Jaberg, Sabine. 2017. Frieden und Sicherheit. In Handbuch Friedensethik , hrsg. von Ines-Jacqueline Werkner und Klaus Ebeling, 43-53. Wiesbaden: Springer VS. Ausgehend von der Definition von Frieden und Sicherheit verhandelt die Autorin beide Begriffe als differente Kategorien und diskutiert Möglichkeiten einer kategorialen Konvergenz.
Nielebock, Thomas. 2016. Frieden und Sicherheit – Ziele und Mittel der Politikgestaltung. Deutschland & Europa: Zeitschrift für Gemeinschaftskunde, Geschichte und Wirtschaft (71): 6-17. Hierbei handelt es sich um einen gut zugänglichen Beitrag zur friedenswissenschaftlichen Debatte beider Begriffe.
3 Friedensforschung und Debatten um ihr Selbstverständnis
Der Diskussion um den Begriff des Friedens und der ihm eingeschriebenen Logiken schließt sich eine weitere Frage im Rahmen dieses Lehrbuchs unmittelbar an: Was heißt Friedensforschung? – oder anders gefragt: Was tun Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wenn sie sich dem Untersuchungsgegenstand Frieden zuwenden?
Diese Frage wird in gleicher Weise divers diskutiert wie der Friedensbegriff selbst. In den Anfangsjahren der Institutionalisierung wurde der Friedensforschung teilweise sogar ihr Status als Wissenschaft abgesprochen. Diesem Einwand lag „ein positivistisches Verständnis von objektiver Wissenschaft“ zugrunde, „vor dem sich Friedensforschung in der Tat nicht rechtfertigen“ ließ. So stellt der Frieden „kein gegebenes Objekt“, sondern „eine konkrete Utopie“ dar. Friedensforschung heißt demnach, über „Bedingungen dieser Utopie“, das heißt über ein „noch nicht realisierte[s] Ziel“ zu forschen (Huber 1971, S.45).
Folgend soll exemplarisch auf drei Definitionen verwiesen werden, die – zu sehr unterschiedlichen Zeiten entstanden – eine relative Stabilität dessen anzeigen, was unter Friedensforschung zu verstehen ist (vgl. Bonacker 2011, S.68):
In den Empfehlungen der Struktur- und Findungskommission zur Friedensforschung vom Januar 2000, einer interdisziplinär und breit aufgestellten Arbeitsgruppe von Friedensforscherinnen und -forschern, eingesetzt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in Vorbereitung zur Gründung der Deutschen Stiftung Friedensforschung, heißt es dazu:
„[Die Friedens- und Konfliktforschung] befasst sich erstens mit der Frage, welche Faktoren dazu beitragen, dass aus Konflikten gefährliche Konflikte werden und welche Möglichkeit zu ihrer Einhegung bestehen. […] Die Friedens- und Konfliktforschung richtet zweitens ihre Aufmerksamkeit auf die Voraussetzungen und Bedingungen eines andauernden – aus Sicht der Beteiligten: gelungenen – Friedens“ (Struktur- und Findungskommission zur Friedensforschung 2000, S.259).
In den jüngsten Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Weiterentwicklung der Friedens- und Konfliktforschung vom Juli 2019 findet sich folgende Definition:
„Die Friedens- und Konfliktforschung befasst sich insbesondere mit Ursachen, Formen, Dynamiken und Folgen von Konflikten und Gewalt sowie mit Möglichkeiten der Prävention, Einhegung oder Beilegung von Konflikten und der dauerhaften Stabilisierung von Frieden.“ (Wissenschaftsrat 2019, S.13)
Ähnlich formulierte er es bereits fünfzig Jahre zuvor. Friedensforschung soll – so der Wissenschaftsrat der Bundesregierung im Mai 1970 – „die Probleme erforschen, die den Frieden in der Welt bedrohen, und die Bedingungen für die Erhaltung bzw. Schaffung des Friedens ermitteln“ (zit. nach DGFK 1983, S.14).
Damit kristallisieren sich für Friedensforscher und -forscherinnen zwei zentrale Tätigkeitsbereiche heraus: die Analyse von Konflikten und deren Ursachen (vgl. Part II dieses Lehrbuchs) sowie die Erarbeitung von Friedensstrategien zu ihrer Einhegung (vgl. Part III dieses Lehrbuchs). Diese beiden hier exemplarisch aufgeführten Definitionen zeigen den engen Zusammenhang von Frieden und Konflikt auf. Nach Harald Müller (2012, S.158, 155) sind sie „ein siamesischer Zwilling“, bei dem man „über den einen nicht sprechen [kann], ohne den anderen mitzuführen“. Das erklärt zugleich die in der Literatur häufig synonyme Verwendung der Termini „Friedensforschung“ und „Friedens- und Konfliktforschung“.
Weitaus kontroverser als die Beschreibung dessen, was Friedensforschung inhaltlich umfasst, ist ihr Selbstverständnis (vgl. Bonacker 2011, S.68). Das beinhaltet vor allem drei Aspekte: Fragen der Normativität, der Praxisorientierung und der disziplinären Verortung der Friedensforschung.
3.1 Zur Normativität der Friedensforschung
Читать дальше