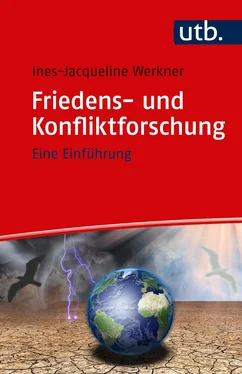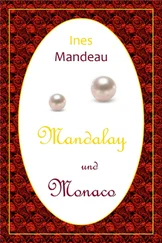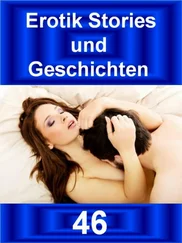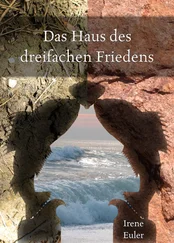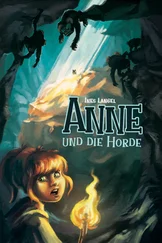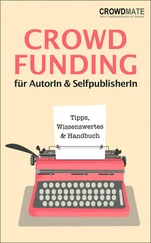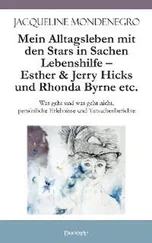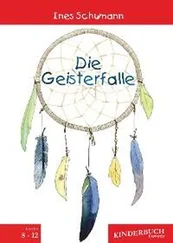Die dritte Dimension beinhaltet die Raumdimension und die Frage, für welches geografische Gebiet Sicherheit angestrebt wird. Im traditionellen Verständnis wird mit Sicherheit die Sicherheit des nationalen Territoriums eines Staates gefasst. Dieser staatszentrierte Zugang steht in einem engen Kontext mit realistischen und neorealistischen Theorieansätzen der Internationalen Beziehungen (vgl. Waltz 1979). Regionale Sicherheitsgemeinschaften wie beispielsweise die NATO beziehen Verbündete in das Sicherheitsstreben mit ein; das Territorialprinzip wird regional, in der Regel auf der Basis eines gemeinsamen Wertefundaments, ausgedehnt – am Beispiel der NATO auf den euro-atlantischen Raum. Eine nochmalige Erweiterung erfolgt mit der internationalen Sicherheit. Dieser sicherheitspolitische Ansatz zielt auf staatliche Koexistenz und zwischenstaatliche Stabilität. Dahinter steht eine institutionalistische Perspektive (vgl. Keohane 1989), verbunden mit der Annahme, dass auch unter Bedingungen der Anarchie des internationalen Staatensystems Kooperationen im gegenseitigen Interesse möglich sind. Ein klassisches Beispiel stellen hier Rüstungskontroll- und Abrüstungsverhandlungen dar. Noch weitreichender greift das Konzept der globalen Sicherheit. Es basiert auf kosmopolitischen Ansätzen und steht in einem engen Kontext mit der menschlichen Sicherheit. Globale Sicherheit geht von einer poststaatlichen Konstellation aus mit der „Menschheit als Ganzes und [der] Aussicht auf eine globale Weltgesellschaft freier Individuen“ (Daase 2010b, S.13).
Die vierte Dimension schließlich erfasst die Gefahrendimension . Mit ihr verbindet sich die Art und Weise, wie Gefahren verstanden und Unsicherheiten konzeptualisiert werden: Das kann auf verschiedenen Wegen erfolgen: „als Abwehr von Bedrohungen, als Verringerung von Verwundbarkeit und als Reduzierung von Risiken“ (Daase 2010a, S.15). Traditionell (wie beispielsweise zu Zeiten des Ost-West-Konflikts) steht Sicherheit für die Abwehr von Bedrohungen. Diese beziehen sich auf territorial begrenzte Räume und setzen „die Existenz eines gegnerischen Akteurs, eine feindliche Intention und ein militärisches Potenzial“ (Daase 2010a, S.15) voraus. In Zeiten wachsender ökonomischer und ökologischer Interdependenzen innerhalb der internationalen Staatenwelt lassen sich Gefahren nicht mehr allein durch feindliche Akteure und ihre militärischen Potenziale ausmachen, sondern auch durch „Verwundbarkeiten“ durch externe Effekte im Sinne von Abhängigkeitsverhältnissen, die eigene Handlungsoptionen einschränken. Seit dem Ende des Kalten Krieges wird zunehmend von Risiken gesprochen. Dazu zählen in erster Linie der transnationale Terrorismus, aber auch die nukleare Proliferation, organisierte Kriminalität oder Migration. Diese Verschiebung von der Bedrohungsabwehr zur Risikovorsorge bedeutet zugleich, Unsicherheiten auf Ungewissheiten auszuweiten. Eine Sicherheitspolitik, die durch Risiken bestimmt wird, „kann nicht länger reaktiv sein, wie im Falle von Bedrohungen, sondern sie muss proaktiv werden und den Risiken ‚begegnen‘“ (Daase 2010a, S.17).
Mit diesen Erweiterungen des Sicherheitsbegriffs gehen zugleich Gefahren einher. Das Streben nach Sicherheit gilt neben Herrschaft und wirtschaftlicher Wohlfahrt als elementare Staatsaufgabe (vgl. Czempiel 2004, S.8), begründet es nach Thomas Hobbes überhaupt erst die Existenz des Staates. Wenn aber Sicherheit „zum Maßstab politischen und gesellschaftlichen Handelns“ erhoben wird, liegt in der Erweiterung des Sicherheitsbegriffs die Gefahr, „sämtliche sozialen und politischen Beziehungen als Abwehr von mutmaßlichen Bedrohungen zu verstehen“ (Gießmann 2011, S.543). Dieses Phänomen wird unter dem Schlagwort der „Versicherheitlichung“ ( securitization ) verhandelt. Dafür steht die in den 1990er Jahren von Barry Buzan, Ole Waever und Jaap de Wilde entwickelte und stark im Konstruktivismus verankerte Kopenhagener Schule (vgl. Buzan et al. 1998). Sie setzt bei der subjektiven Dimension von Sicherheit an. Danach konstruieren Sprechakte, konkret die Benennung von Problemen als Sicherheitsprobleme, einen Ausnahmezustand, der außerordentliche Maßnahmen rechtfertigt und bestehende Entscheidungswege außer Kraft setzen kann.1
2.2 Friedens- versus Sicherheitslogik
Die Begriffe Frieden und Sicherheit lassen Parallelen, aber auch Divergenzen erkennen. Einerseits zeigt der erweiterte Sicherheitsbegriff – wie am Beispiel menschlicher Sicherheit – „eine große Nähe zu den von Picht eingeführten Konstitutionsbedingungen des Friedens“ (Nielebock 2016, S.9) auf. Die Kriterien menschlicher Sicherheit nach dem Bericht der Entwicklungsorganisation der Vereinten Nationen (UNDP 1994, S.3) als freedom from fear (Freiheit von Furcht) und freedom from want (Freiheit von Not) korrespondieren offensichtlich mit den Picht’schen Parametern des Friedens (Schutz gegen Gewalt, Schutz vor Not und Schutz der Freiheit). Andererseits erweisen sich Frieden und Sicherheit aber auch als „differente Kategorien“ (Jaberg 2017a, S.43) und „nicht […] auf gleicher Ebene verrechenbare Größen“ (Daase und Moltmann 1991, S.45). Beide Begriffe implizieren unterschiedliche Logiken. Dahinter stehen eigene Formen beziehungsweise Grammatiken, die sich im Laufe der Geschichte herausgebildet haben und das Denken und Handeln innerhalb der jeweiligen Kategorien prägen (vgl. Jaberg 2017b, S.170).
Nach der Friedensforscherin Sabine Jaberg (2017a, S.46) zeigen sich in der Auseinandersetzung mit den Begriffen Frieden und Sicherheit zwei kategoriale Differenzen: Während erstens Frieden nur gemeinsam mit anderen Akteuren verwirklicht werden könne und in diesem Sinne einen sozialen Begriff darstelle, müsse Sicherheit – insbesondere in ihrem traditionellen Verständnis als Sicherheit vor oder gegen andere – als „asozialer Begriff“ gefasst werden, der vom einzelnen Akteur her denke. So komme im Kontext von Sicherheit dem Anderen keine eigene Wertigkeit zu, diese ergebe sich vielmehr aus der Relevanz für das eigene Sicherheitsstreben. Zweitens setze Frieden – zielt dieser Begriff auf Gewaltfreiheit – den Akteuren Grenzen. Das „wechselseitige Anerkennungsverhältnis“ fordere von ihnen als innere Haltung „Liebe“, „Güte“ und die „Einsicht in die prinzipielle Untauglichkeit gewaltsamer Mittel“ sowie im konkreten Handeln „den Abbau gewaltgenerierender Strukturen und den Aufbau friedlicher Bearbeitungskapazitäten“. Eine Sicherheitslogik weise „diesbezüglich keine immanenten Schranken“ auf. Im Gegenteil, sie tendiere zur Grenzenlosigkeit bezüglich (a) der Wahl der Mittel, denn auch Krieg werde unter Umständen als legitim erachtet; (b) des Zeitrahmens, der gegebenenfalls ein präemptives oder gar präventives Agieren gerechtfertigt erscheinen lasse; (c) der Reichweite, wonach prinzipiell jedes Politikfeld als sicherheitsrelevant betrachtet werden könne (Versicherheitlichung) sowie (d) der Reaktion der Exekutive, von der Dramatisierung der Lage bis hin zu einer Eskalation im Handeln (vgl. Jaberg 2014).
Auch die Friedensforscherin Hanne-Margret Birckenbach (2014) differenziert zwischen einer Friedens- und Sicherheitslogik. In ihren Ausführungen fokussiert sie auf fünf zentrale Prinzipien friedenslogischen Denkens und Handelns:
das Prinzip der Gewaltprävention (mit der Zielsetzung, „vorausschauend deeskalierend tätig“ zu sein);
das Prinzip der Konflikttransformation (basierend auf dem Verständnis, dass Gewalt nicht außerhalb, sondern zwischen Konfliktparteien entsteht, und auch der eigene Anteil an Gewalt reflektiert werden muss);
das Prinzip der Dialog- und Prozessorientierung (mit dem Ziel, in einer zunehmend interdependenten Welt „Gelegenheiten für einen verstärkten Austausch von und mit möglichst vielen politischen und gesellschaftlichen Kräften [zu suchen]“);
Читать дальше