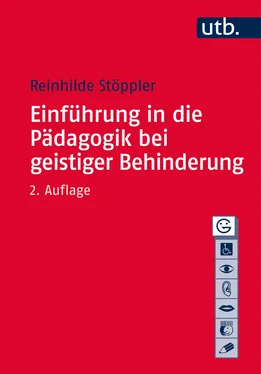Das vorliegende (Lehr-)Buch gibt eine Einführung in zentrale Themen dieser interessanten Wissenschaft. Aufgrund des stetigen Wandels, dem sie unterworfen war und ist, kann es sich bei dieser Einführung nur um eine Beschreibung des momentanen Standortes und der wegweisenden Perspektiven handeln.
In jedem Lehrbuch der Pädagogik bei geistiger Behinderung werden Sie den Hinweis finden, dass es den „geistig Behinderten“ nicht gibt und dass es schwer ist, einen Begriff für diese heterogene Gruppe zu finden. So auch in diesem Buch, in dem im ersten Kapitel der Versuch unternommen wird, Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung in ihren „Besonderheiten“ aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven zu beschreiben.
Kapitel 2gibt eine Einführung in die Ätiologie der geistigen Behinderung, d. h. eine Beschreibung der Entstehungsbedingungen.
Im dritten Kapitel erfolgt ein Überblick über bekannte und häufig vorkommende Syndrome der geistigen Behinderung; fokussiert wird außerdem eine Gruppe, die die besondere Heterogenität des Personenkreises verdeutlicht: Menschen mit schwersten Behinderungen, die am längsten von Bildung exkludiert waren.
In Kapitel 4wird beschrieben, wie sich die Leitideen in der Bildung und Erziehung für Menschen mit geistiger Behinderung verändert haben. Dargestellt werden vergangene und aktuelle Leitideen der Pädagogik bei geistiger Behinderung sowie wichtige Daten und Personen in ihrer Geschichte.
Die aktuelle Inklusions- und Teilhabedebatte umfasst die gesamte Lebenslaufperspektive und somit alle Altersphasen. Aus diesem Grund erfolgt in den Kapiteln 5– 8ein Überblick über Bildung und Teilhabe in allen Phasen des Lebenslaufs, vom Säugling bis zum alten Menschen.
Kapitel 5beginnt mit der Phase der frühen Bildung und Erziehung, die hier in Frühförderung und Elementarbildung eingeteilt wird. Kapitel 6widmet sich dem schulischen Bereich inklusive den verschiedenen Förderorten. Berufliche Bildung bzw. berufliche Tätigkeit als zentraler Teilhabefaktor im Lebenslauf wird in Kapitel 7in den Blick genommen. Kapitel 8gibt eine Einführung in ein breites Themenspektrum, das Menschen mit geistiger Behinderung im Alter betrifft. In Kapitel 9erfolgt eine Einführung in zentrale Teilhabebereiche und pädagogische Handlungsfelder: Gesundheit, Mobilität, Wohnen, Freizeit, Erwachsenenbildung, Sexualität mit einem Exkurs zum Genderaspekt sowie Politik. Dabei werden jeweils zentrale Aspekte, die aktuelle Situation sowie Teilhaberisiken und -chancen vorgestellt. Zugleich erfolgen Hinweise auf wegweisende Good-Practice-Beispiele, die sich auf dem Weg zur gleichberechtigten Teilhabe befinden und versuchen, sich am Inklusionsziel zu orientieren.
Eine zentrale Teilhabeeinschränkung können Menschen mit geistiger Behinderung durch nicht ausreichende bis mangelnde Bildung und Förderung individueller Lern- und Leistungspotentiale in zentralen Teilhabebereichen erfahren. Bildung ist der Schlüssel zur Teilhabe; Bildung bestimmt maßgeblich über Teilhabechancen und Zugang zu Teilsystemen. Aus diesem Grund werden in diesem Lehrbuch Bildungsangebote und pädagogische Handlungsfelder für den schulischen und außerschulischen Bereich in jedem Kapitel besonders fokussiert.
Im Glossar werden zentrale und in diesem Buch häufig vorkommende Begriffe, deren Unterscheidung in Theorie und Praxis der Pädagogik bei geistiger Behinderung von Bedeutung ist, beschrieben. In jedem Kapitel gibt es Hinweise auf die entsprechenden Artikel der UN-BRK.
Zur Einführung in die Kapitel finden sich thematisch passende Zitate von Menschen mit Behinderung, als Plädoyer dafür, dass man – im Sinne einer partizipativen Forschung – nicht immer über sie, sondern mit ihnen sprechen und sie einbeziehen sollte.
Weitere wichtige und weiterführende Informationen sind im Online-Material auf www.reinhardt-verlag.debzw. utb-shop.de nachzulesen; die Textstellen sind entsprechend gekennzeichnet.
Ich möchte mich herzlich bedanken bei Dr. Heiko Schuck, Dr. Julia Wilke, Dr. Karoline Klamp-Gretschel und Melanie Knaup für das außerordentlich kompetente Formatieren und Korrekturlesen, bei Alexandra Bugl für unermüdliche Literaturrecherchen, bei Maren Müller-Erichsen für kreative inklusive Ideen, bei Norbert Heinen für viele interessante Anregungen.
Dieses Buch ist meinen verstorbenen Eltern gewidmet, die mir Bildung ermöglicht haben. Danke. Für alles.
Gießen, im Dezember 2016,
Reinhilde Stöppler
Hinweise zur Benutzung dieses Lehrbuches
Das vorliegende Buch will Studienanfängern und Studienanfängerinnen der Pädagogik bei geistiger Behinderung sowie interessierten Studierenden verwandter Studienfächer (Pädagogik, Psychologie, Sozialpädagogik und Soziale Arbeit) einen Einblick in die vielfältigen Aufgabengebiete und Handlungsfelder der Pädagogik bei geistiger Behinderung geben. Eine weitere Zielgruppe sind Lehrkräfte der allgemeinen Grund-, Haupt- und Realschulen, die sich im Kontext inklusiver Maßnahmen in das Thema einarbeiten und sich über Ätiologie und Erscheinungsmöglichkeiten geistiger Behinderungen sowie Bildungs- und Fördermöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung informieren möchten.
Der beabsichtigte Überblickscharakter des Buches macht inhaltliche Verkürzungen unvermeidbar, will aber gerade hierdurch Studienanfänger und Studienanfängerinnen zu weiterführender Auseinandersetzung mit Einzelfragen des Faches motivieren. Die formale Gestaltung des Buches soll das Selbststudium erleichtern.
Die in den Randspalten angegebenen Hinweise und Piktogramme dienen der schnellen Orientierung und die gezielten Fragen und Aufgaben am Ende eines Kapitels der Reflexion des Gelesenen. Denkanstöße und spezifische Literaturhinweise sollen zur weiterführenden Vertiefung von Einzelaspekten anregen. Das Glossar am Ende des Buches klärt zentrale Fachbegriffe.
 |
Definition |
 |
Literaturempfehlung |
 |
Übungsaufgaben |
 |
Online-Zusatzmaterial |
Auf der Homepage des Ernst Reinhardt Verlages und der UTB GmbH finden Sie bei der Darstellung dieses Titels Musterlösungen zu den im Buch enthaltenen Übungsaufgaben zum Herunterladen sowie Ergänzungen zu einzelnen Kapiteln.
www.reinhardt-verlag.de, www.utb-shop.de
1 Personenkreis der Menschen mit geistiger Behinderung
1.1 Begriff „geistige Behinderung“
„Es war voll im Bus und ich musste hinten sitzen, wo die halbstarken Jugendlichen Platz haben, und da saß ein Jugendtyp. […] Da holt er mit dem Arm aus und sagt zu mir „Du Spasti“, und das wollte ich nicht hören. Für ein Handicap ist das eine Beleidigung. Da war ich sauer auf ihn. Der Spruch Spasti hat mir weh getan, den hat er sicher von Hitler gehört“ (Müller-Erichsen 2010, 10).
Beschreibungsversuche
Der Begriff geistige Behinderung steht am Ende einer langen Reihe von Be- und Umschreibungsversuchen für eine äußerst heterogene Gruppe von Menschen. Es gibt keine einheitliche Beschreibung oder Kennzeichnung des als geistig behindert definierten Personenkreises. Das liegt u. a. daran, dass Menschen mit geistiger Behinderung keine einheitliche Gruppe mit festgesetzten und -umschriebenen Eigenschaften bilden. Nicht einmal vorübergehend ist es möglich, sich in die Lage und Situation eines Menschen mit geistiger Behinderung zu versetzen. So ist der Begriff im Grunde genommen sehr unklar. Dagegen ist es leichter, sich für eine kurze Zeitspanne annähernd in die Perspektive eines blinden, gehörlosen oder gehbehinderten Menschen zu versetzen, indem wir versuchen, eine alltägliche Situation mit verbundenen Augen, Ohren oder im Rollstuhl zu erleben und dabei die Barrieren der Lebensumwelt zu erfahren.
Читать дальше