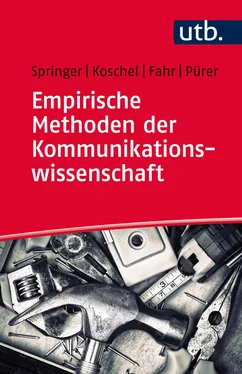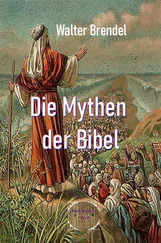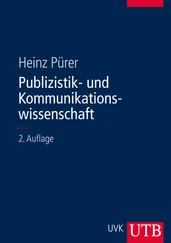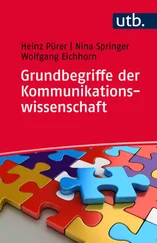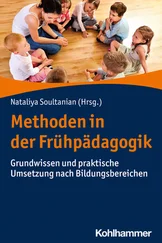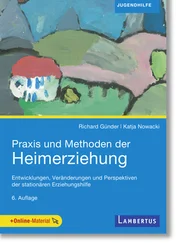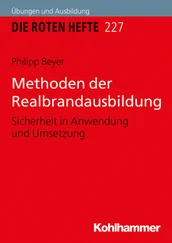In seinem 2003 erstmals publizierten sowie 2014 umfassend überarbeiteten und erweiterten Lehrbuch »Publizistik- und Kommunikationswissenschaft« hat Heinz Pürer, teils unter Mitwirkung weiterer Autoren, das Lehr- und Forschungsfeld dieser Disziplin inhaltlich strukturiert und umfassend aufbereitet. Es erscheint nun – neu konfektioniert und leicht überarbeitet – auch in Teilbänden. Der vorliegende Band enthält, wie sein Titel sagt, den Abschnitt über »Empirische Forschungstechniken der Kommunikationswissenschaft«. Eingangs enthält der Band Einführungen in die quantitative und qualitative Sozialforschung, ehe im Weiteren die Forschungsmethoden und -designs selbst dargestellt werden: Befragung, Inhaltsanalyse, Beobachtung und Experiment. An seinem Ende enthält der Band neben dem Verzeichnis der verwendeten Quellen Hinweise auf ausgewählte, einschlägige Standardwerke zu den empirischen Forschungstechniken, denen es in ausführlicherer und differenzierterer Weise als hier möglich ist, detaillierte und vertiefende Informationen zu den sozialwissenschaftlichen Forschungstechniken zu vermitteln.
Weitere Teilbände sind wichtigen Grundbegriffen der Kommunikationswissenschaft, der Kommunikator- bzw. Journalismusforschung, der Medienforschung und den Medienstrukturen in Deutschland sowie der Kommunikationswissenschaft als interdisziplinäre Sozialwissenschaft gewidmet. Die Bände erscheinen auch als E-Books. Mit diesem Publikationsprogramm sollen Interessenten angesprochen werden, die sich ein Teilgebiet der Publizistikund Kommunikationswissenschaft einführend erschließen wollen.
Wir danken Herrn Rüdiger Steiner, Verlagslektor von UVK, für die gute Zusammenarbeit bei der Entstehung dieses Buches
| München und Fribourg,im September 2015 |
Nina SpringerFriederike KoschelAndreas FahrHeinz Pürer |
Die Klärung wissenschaftlicher Fragestellungen verlangt stets nach dem Einsatz geeigneter Methoden und Forschungstechniken, um Antworten auf diese Fragen zu finden. Dabei bestimmt die Fragestellung die Methode (und nicht umgekehrt). In der Kommunikationswissenschaft finden, wie in der Einleitung erwähnt, je nach theoretischem Standort des Forschers und je nach konkreter wissenschaftlicher Fragestellung unterschiedliche Methoden Anwendung. Dabei wird im Allgemeinen unterschieden zwischen der erfahrungsbasierten (= empirischen) Sozialforschung im engeren Sinn, die sich qualitativer und quantitativer Methoden bedient, und weiteren Denkschulen wie z. B. der Hermeneutik, die sich mit der Auslegung von Texten und dem Verstehen beschäftigt und dabei ganzheitlicher ausgerichtet ist. Ausgehend von einem sozialwissenschaftlich orientierten Selbstverständnis des Faches werden in diesem Band jene empirischen Forschungstechniken und -strategien vorgestellt, derer sich die Kommunikationswissenschaft bedient, um ihre Lehr- und Forschungsfragen aufzuarbeiten. Was im Folgenden nicht geleistet wird, sind Reflexionen zu Paradigmen (Denkschulen) und damit zu wissenschaftstheoretischen Erwägungen über die Methoden der Sozialwissenschaften. Die Logik der Forschung, also die Frage nach den Ursprüngen sozialwissenschaftlichen Forschens und den dieser Logik angemessenen Vorgehensweisen, wird nur kurz thematisiert. Gleiches gilt für Überlegungen zur Statistik, also zu jenen mathematischen Prüfverfahren, die im Kontext der Anwendung quantitativer empirischer Methoden zur Auswertung der Daten herangezogen werden. Zu beidem wird nachfolgend, an geeigneter Stelle, auf weiterführende Literatur verwiesen.
Doch zurück zu den Methoden der empirischen Sozialforschung, die in einer sozialwissenschaftlich ausgerichteten Kommunikationswissenschaft angewendet werden. Die wichtigsten Erhebungsmethoden der empirischen Kommunikationsforschung sind:
• Befragung
• Inhaltsanalyse
• wissenschaftliche Beobachtung.
Das wissenschaftliche Experiment , das auch in der Kommunikationswissenschaft zum Einsatz kommt, ist keine Methode im klassischen Sinn, sondern eine Untersuchungsanordnung . Man unterscheidet also zwischen experimentellen und nichtexperimentellen Untersuchungsanordnungen. Die Methoden der Kommunikationsforschung – Befragung, Inhaltsanalyse und Beobachtung – können demnach auch im Rahmen einer experimentellen Untersuchungsanordnung eingesetzt werden. Dies wäre z. B. der Fall, wenn zwei Gruppen von Befragten einen Fragebogen ausfüllen müssten, in dem lediglich die Reihenfolge von zwei Fragen vertauscht ist. Wenn sich nach der Auswertung der Fragebögen herausstellt, dass sich beide Gruppen in der Beantwortung dieser beiden Fragen systematisch unterscheiden, kann man folgern, dass die Reihenfolge der Fragen einen Effekt auf die Beantwortung hat. Man hätte in diesem Fall eine Befragung im Rahmen eines wissenschaftlichen Experiments durchgeführt (Noelle-Neumann/ Petersen 2005, S. 469f ). Die streng kontrollierte Variation einzelner Faktoren erlaubt zudem den Nachweis kausaler Zusammenhänge. Demnach wäre die Reihenfolge der Fragen die Ursache, das daraus resultierende Antwortverhalten die Wirkung.
An diesem Beispiel erkennt man bereits, dass das Experiment sich v. a. zum Testen von Hypothesen eignet (und daher v. a. in standardisierten quantitativen Forschungsdesigns zum Zug kommt). Die drei Erhebungsmethoden (Befragung, Inhaltsanalyse, Beobachtung) werden in quantitativen und qualitativen Forschungsprojekten gleichermaßen eingesetzt. Die gängigsten Varianten werden im Anschluss an die einführenden Bemerkungen zu quantitativer und qualitativer Methodenlehre vorgestellt.
1 Quantitative Sozialforschung
1.1 Allgemeine Anforderungen und Gütekriterien
Unter einer empirischen Methode versteht man allgemein das Verfahren, wie Daten erhoben werden . Oder konkreter formuliert: Empirische Methoden bzw. Forschungstechniken sind Vorgehensweisen, durch deren systematische Anwendung im Rahmen eines festgelegten Forschungsplans wissenschaftliche Fragestellungen beantwortet werden sollen. In dem Begriff »Forschungstechnik« sind per Definition vier wesentliche Aspekte enthalten:
1) das Postulat der Wissenschaftlichkeit
2) die Forderung nach systematischer Anwendung
3) eine festgelegte, in der Wissenschaft zustimmungsfähige Vorgehensweise
4) die Beantwortung einer oder mehrerer Forschungsfragen.
1) Das Postulat der Wissenschaftlichkeit beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Wissenschaft und Alltagsverstand. Eine sich sozialwissenschaftlich und empirisch verstehende Kommunikationswissenschaft will gültige Aussagen über Fragen zur sozialen Realität machen. Dies können z. B. Fragen nach den Ursachen für Wahlergebnisse durch Medienberichterstattung, nach Motiven des individuellen Fernsehkonsums oder nach den Themenstrukturen und -agenden von Tageszeitungen sein. All dies sind zunächst Fragen, mit denen sich Menschen auch »privat« befassen. Sie diskutieren das letzte Wahlergebnis, fragen, was die Freunde gestern im Fernsehen angeschaut oder ob sie heute schon die Zeitung gelesen haben. Worin liegt nun der Unterschied zwischen Alltagsverstand und wissenschaftlicher Betrachtung? Der sog. Alltagsverstand, die subjektive Meinung einer einzelnen Person, ist ein willkürlicher, partikularer Aspekt aus vielen ebenfalls existierenden Meinungen. Er hat zwar für die Person, vielleicht für eine Gruppe von Freunden (sog. Peergroups) Relevanz; keineswegs kann jedoch eine singuläre Meinung allgemein relevante Aussagen über »die Gesellschaft«, »den Fernsehzuschauer« oder »die Qualitätszeitungen« machen. Einzelne, spontan beobachtete Meinungen genügen dem Postulat der Wissenschaftlichkeit i. d. R. nicht (vgl. Brosius/Haas/ Koschel 2012, S. 7f). Wissenschaftliches Vorgehen erfordert einen systematischen Plan (s. Punkt 2), muss in allen Schritten transparent und dadurch intersubjektiv nachvollziehbar sein und nach Regeln erfolgen, die in der wissenschaftlichen Teildisziplin zustimmungsfähig sind (s. Punkt 3).
Читать дальше