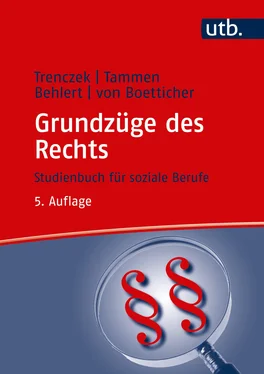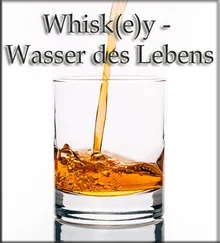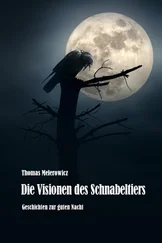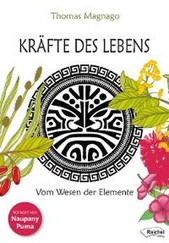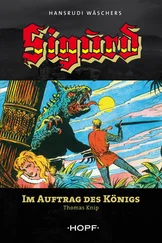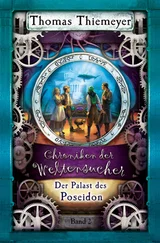In einem modernen Rechtsstaat begrenzt sich die Funktion des Rechts freilich nicht darauf, orientierende Leitlinie für das Sozialverhalten seiner Bürger zu sein, die Menschenwürde zu sichern, persönliche Freiheit zu gewährleisten und soziale Kontrolle rechtsstaatlich abzusichern (sog. Grenzziehungsauftrag und Herrschaftskontrolle). Wesentlich sind vor allem die Strukturierung des Gemeinwesens und seiner wesentlichen öffentlichen Institutionen (Ordnungsfunktion) sowie – im Zusammenspiel mit dem Sozialstaatsprinzip – der Auftrag zur Chancenermöglichung (Emanzipation und Aktivierung) und der Gewährung gesellschaftlicher Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger. Auch wenn sich damit die Idee des Rechts an der Gerechtigkeit orientiert (hierzu 1.2), kann dieses Ziel immer nur ansatzweise erreicht werden, da im Widerstreit gesellschaftlicher und privater Interessen auch im besten Fall nur ein fairer Interessensausgleich geleistet werden kann.
1.1.2 Woher kommt das Recht? Die Genese der Rechtsnormen
Naturrecht
Bräuche und Sitten haben sich aufgrund der mit ihnen gemachten Erfahrungen gewohnheitsmäßig herausgebildet. Recht kann sich aus unterschiedlichen Quellen speisen. Als ungeschriebene Grundlage des Rechts wird häufig das sog. Naturrecht bezeichnet, also eine verbindliche Grundordnung, die der Mensch als gegeben hinnimmt, weil sie seiner Natur und seiner Vernunft entspricht. Hierauf basierte die Stoa, die 300 v. Chr. von Zenon dem Jüngeren gegründete Athener Denkschule, nach der das Recht nicht vom Staat begründet, sondern als ein allgemeines Naturgesetz angesehen wurde. Auch das für das heutige bürgerliche Recht in vieler Hinsicht einflussreiche Römische Recht basierte auf diesem Prinzip und es war in der modernen Rechtsgeschichte ein Dauerthema, wie viel „Natur“ das Recht besitzt bzw. verträgt. Uwe Wesel vergleicht das Naturrecht mit einem Zylinder, aus dem nur das herausgezaubert werden könne, was man vorher hineingelegt habe (Wesel 1994, 73). Mit der Natur hat man in der Vergangenheit alles Mögliche begründet, die Sklaverei genauso wie die Abschaffung der Sklaverei, die Gleichheit der Menschen wie die tiefste Barbarei. Insofern ist Zurückhaltung gegenüber naturrechtlichen Begründungen grds. angebracht. Dennoch muss gesehen werden, dass die klassischen Naturrechtskonstruktionen historisch insofern fortschrittlich sind, als sie die Vorstellung von einem „göttlichen Recht“ ablösen und zugleich, wie etwa bei Kant, darauf verweisen, dass das Recht nicht nur das Resultat rationaler Regelsetzung ist, sondern auch an empirische Voraussetzungen anknüpft. Hiermit ist vor allem die bei Kant so bezeichnete „Natur des Menschen“ gemeint, die der Vernunft zwar prinzipiell zugänglich ist, gleichwohl aber außerhalb und unabhängig von ihr existiert (Kant 1797, 345).
Universalitätsprinzipien
Auch unser heutiges mitteleuropäisches Rechtsverständnis ist von naturrechtlichen Vorstellungen beeinflusst, jedoch sind konkrete naturrechtlich begründete Glaubenssätze kaum noch zu finden. Gelegentlich wird allerdings die vom Grundgesetz als „natürliches Recht“ bezeichnete Erziehungsverantwortung der Eltern für ihre Kinder (Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG) zumindest teilweise als ein solcher angesehen (Gernhuber / Coester-Waltjen 2010, 38 f.).Tatsächlich handelt es sich bei Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG aber um positiv gesetztes Verfassungsrecht, das in der Rechtsprechung des BVerfG immer wieder auf faktische soziale Lebensverhältnisse bezogen wird, die einem permanenten Wandel unterliegen (hierzu ausführlich: Münder et al. 2013a, 34 ff.). Naturrechtliche Begründungen finden sich heute vornehmlich im Kontext der Menschenrechtsdiskurse, in denen von angeborenen Rechten des Menschen gesprochen wird, die in seiner Würde fundiert seien (hierzu: Opitz 2002, 12). Insofern werden Menschenrechte teilweise auch vom Standpunkt der Moral aus begründet (vgl. Tugendhat 1993, 336). In einer eher legalistischen Perspektive hingegen (z. B. Habermas 1992, 156) geht die heute angenommene universelle Geltung von Menschenrechten jedoch nicht aus ihrer naturrechtlichen Begründung hervor, sondern ergibt sich aus der „Bereitschaft der Staaten zum Abschluss entsprechender völkerrechtlich verbindlicher Vereinbarungen“ (Opitz 2002, 15). Solche heute als universell vereinbart geltende Menschenrechtsprinzipien finden sich z. B. in den Grundsätzen, die 1950 durch die Mitglieder des Europarates in der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten beschlossen wurden EMRK (u. a. Gewissens- und Religionsfreiheit, Recht auf freie Meinungsäußerung, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, Unschuldsvermutung, Folterverbot), in der von der Generalversammlung der Vereinten Nationen angenommenen Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 10.12.1948 sowie in den beiden UN-Menschenrechtspakten vom 19.12.1966 (Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte sowie Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte; beide in Kraft seit 1976; hierzu 1.1.5.2). Allerdings zeigen auch die Jahresberichte von Amnesty International, dass die Universalität der Menschenrechte nicht überall akzeptiert, vielmehr auf der Welt täglich mit Füßen getreten wird. Daher war insb. in der Vergangenheit das aus dem universellen Geltungsanspruch der Menschenrechte abgeleitete, vor allem für das Völkerstrafrecht, aber auch das innerstaatliche Strafrecht (hierzu IV) bedeutsame sog. Universalitätsprinzip praktisch der einzige Anker, um rechtspositivistische Unrechtsregimes als Barbarei und gesetzliche Regelungen als Unrecht zu bezeichnen (vgl. z. B. die Frage der Rechtmäßigkeit des Schießbefehls an der DDR-Grenze nach § 27 Abs. 2 DDR-Grenzgesetz: BGH NJW 1993, 141; BVerfGE 95, 96 ff.; BVerfG 2 BvQ 60 / 99 – 11.01.2000). In diesem Zusammenhang hat der EGMR in seiner „Krenz“-Entscheidung (EGMR Nr. 1101 – 22.03.2001 – 34044 / 96) betont, dass sich selbst ein einfacher Soldat nicht blind auf Befehle berufen kann, die nicht nur krass gegen die innerstaatlichen gesetzlichen Grundsätze, sondern auch gegen die international geschützten Menschenrechte und vor allem gegen das Recht auf Leben, das höchste Rechtsgut in der Werteskala der Menschenrechte, verstoßen. Völkerrechtlich wird dem Universalitätsprinzip heute mittlerweile mit der Einrichtung des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) in Den Haag Geltung verschafft, vor dem Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Anklage kommen.
Religion und Moral
Früher galten auch Religion und Moral als wichtige Quellen des Rechts (vgl. Wesel 1984, 194 ff.). Im Verständnis der katholischen Kirche basiert das Kanonische Kirchenrecht auf dem göttlichen Willen. Zu allen Zeiten der Menschheitsgeschichte wurde durch philosophisch oder religiös begründete Moralvorstellungen von Gut und Böse und eine darauf basierende Sittenlehre festgelegt, was im Leben und in der Welt wertvoll ist. Die jeweils herrschenden Sitten und Moralvorstellungen wurden in eine Rechtsform gegossen. Bis in die Anfänge der Bundesrepublik (vgl. die Entscheidung des BGH 6, 46 ff. über die „Normen des Sittengesetzes“ und die „vorgegebenen und hinzunehmende Ordnung der Werte“ im Hinblick auf die Definition und Strafbarkeit der „Unzucht“) wurde auf eine ursprüngliche Einheit von Sitte und Recht, ja auch von Moral, Religion und Recht Bezug genommen. Dies konnte möglicherweise schon damals als Anachronismus gelten, handelt es sich hierbei doch eher um ein Kennzeichen sog. vorstaatlicher, oraler Gesellschaften. Allerdings beanspruchen auch heute in einer durch Internationalisierung und Migration gekennzeichneten Gesellschaft religiös (z. B. islamisch) geprägte Regelungen insb. im Internationalen Privatrecht (s. 1.1.6) wieder zunehmend Geltung.
Gerade mit Blick auf die permanenten Diskussionen über die Verschärfung des Strafrechts im Hinblick auf Prostitution und Kinderpornografie werden in der Öffentlichkeit wieder (vor)schnell moralische Kategorien zur Grundlage der Strafbarkeit erhoben. Weil Strafrecht (hierzu IV-1.3) aber ultima ratio, das letzte und (vermeintlich) schärfste Mittel des Rechts ist, darf es nicht ein Moralrecht sein. Seine Funktion darf nicht dahingehend ausgeweitet werden, dass mit ihm Meinungsverbote und Tabus durchgesetzt und als anstößig empfundenes künstlerisches Wirken verbannt werden (vgl. IV-2.3.3; ausführlich zum strafrechtlichen Schutz von Moral, Gefühlen und Tabus: Hörnle 2004a). Begrenzungen der Handlungsfreiheit sind in den Schranken des Art. 2 Abs. 1 GG vor allem im Hinblick auf die schützenswerten „Rechte anderer“ legitim. Insoweit ist der Strafgesetzgeber zweifellos gefordert, das Rechtsgut der sexuellen Selbstbestimmung gerade in Bezug auf Kinder, die dies entwicklungsbedingt noch nicht selbst können, effektiv zu schützen. Aber auch hier gilt, dass nur das, was in grober Weise sozialschädlich und damit wirklich strafwürdig ist, unter Strafe zu stellen ist.
Читать дальше