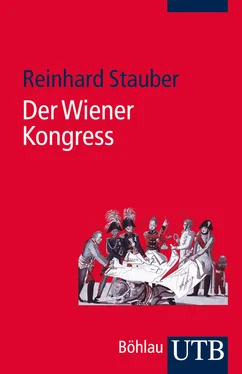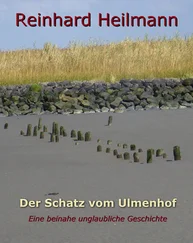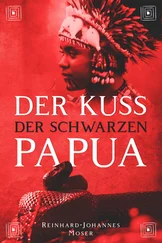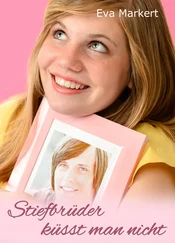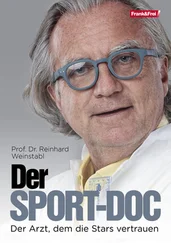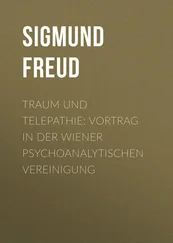Auch der britische Prinzregent Georg formalisierte seine Unterstützung für die Allianz in Gestalt von zwei Konventionen, die sein Gesandter beim Zaren, William Earl Cathcart, in Reichenbach mit Preußen und Russland (14./15. Juni) abschloss. Dabei ging es, einer schon länger geübten Tradition entsprechend, vor allem um Subsidienzahlungen: Über 1,1 Mio. Pfund wurden dem Zaren, über 660.000 Pfund dem Preußenkönig für Militärausgaben im Jahr 1813 zur Verfügung gestellt. Berlin bekam nun [<<22] auch von den Briten seine Wiederherstellung nach dem Territorialstand von 1806 zugesagt, und mit Nesselrode vereinbarte Cathcart eine Abstimmung künftiger militärischer Aktionen sowie den Verzicht auf einseitige Verhandlungen mit Napoleon.5
Metternich traf mit Napoleon am 26. Juni 1813 zu einem langen Gespräch in Dresden zusammen, um die Möglichkeit zur Aufnahme von Friedensverhandlungen auszuloten. Napoleon lehnte territoriale Zugeständnisse im Sinne der Reichenbacher Forderungen rundheraus ab. Auf formaler Ebene errang Metternich aber einen wichtigen Erfolg, denn der Empereur entließ Österreich aus den Verpflichtungen des Bündnisvertrags von 1812 und anerkannte seine Rolle als neutraler Vermittler.
In dieser Rolle gelang es Metternich, Zar Alexander und König Friedrich Wilhelm die Entsendung von Bevollmächtigten nach Prag abzuhandeln, wo er ab dem 11. Juli die Unterredungen aufzunehmen gedachte. Andererseits beteiligten Schwarzenberg und Radetzky sich an den militärischen Planungen der Koalition (zu der inzwischen auch Jean-Baptiste Bernadotte, ehemaliger Marschall Napoleons und seit 1810 als Karl Johann Kronprinz von Schweden, gestoßen war) für ein gemeinsames Vorgehen in Sachsen; der im niederschlesischen Trachenberg am 12. Juli 1813 fertiggestellte Operationsplan sah die Aufstellung von drei Hauptarmeen in Böhmen (unter Schwarzenberg), in Schlesien (unter Blücher) und an der Elbe („Nordarmee“ Bernadottes) vor.6
Napoleon setzte bei den Prager Verhandlungen auf eine leicht durchschaubare Verzögerungstaktik. Sein erster Vertreter war weder mit Instruktionen noch mit Vollmachten ausgestattet; erst am 22. Juli erhielt der zweite Abgesandte, Graf Caulaincourt, General, Senator und langjähriger diplomatischer Vertreter des Kaisers am Zarenhof, wenigstens erstere, blieb aber ohne Ermächtigung zu einem Abschluss. Eingehend und erfolglos wurde über Verfahrensfragen gestritten. Napoleon verlangte eine Einbeziehung der Briten und wollte auch nach eindringlicher [<<23] Erinnerung an die Reichenbacher Forderungen der Alliierten (der noch die Aufgabe des Protektorats über den Rheinbund hinzugefügt wurde) keine Veränderungen am Status quo von 1812 akzeptieren. Ernsthafte Verhandlungen kamen in Prag jedenfalls nicht zustande.
Am 10. August erklärten Preußen und Russland ihre Vollmachten für erloschen; neue, nach größerer Kompromissbereitschaft klingende französische Vorschläge wurden nicht mehr behandelt. Am 12. August 1813 erfolgte die formelle Kriegserklärung Österreichs an Frankreich. Es war offensichtlich, dass Napoleon im Sommer 1813 „nicht ernsthaft an einen Frieden der Verständigung [dachte], bei dem er … hätte Konzessionen machen müssen. Vielmehr baute er weiterhin auf seine militärische Schlagkraft …“7
Die militärischen Auseinandersetzungen flammten ab der letzten Augustwoche 1813 rund um Napoleons Zentralposition in Sachsen neu auf. Blücher hielt den französischen Marschall MacDonald erfolgreich von Schlesien ab (Schlacht an der Katzbach 26. August). Der Empereur konnte seine Stellung in Dresden gegen Schwarzenbergs Armee behaupten (26./27. August), nicht aber mit Erfolg offensiv gegen Böhmen vorgehen (Schlacht bei Kulm 29./30. August). Vorstöße der Marschälle Oudinot und Ney Richtung Berlin wehrten preußische Verbände der Nordarmee ab (Großbeeren 23. August; Dennewitz 6. September).
Anfang September flauten die Kämpfe, die Napoleon größere Verluste gekostet hatten als die drei Alliierten, wieder ab. Im nordböhmischen Teplitz kamen die Monarchen Österreichs, Preußens und Russlands zusammen, um ihre gemeinsamen politischen Ziele neu festzuschreiben. Sie wurden in einem geheimen Zusatzartikel zum Allianzvertrag vom 9. September 1813 festgehalten: Wiederherstellung Österreichs und Preußens nach dem Territorialstand von 1805, einvernehmliches „arrangement“ der drei Höfe über die neue Konfiguration Polens, Wiederherstellung Hannovers, Auflösung des Rheinbunds bei Bewahrung der Souveränität seiner Mitgliedsstaaten und, besonders wichtig, eine enge gemeinsame Abstimmung der künftigen Politik („travailler de concert“ lautete der [<<24] Fachausdruck in der Diplomatensprache Französisch).8 Großbritannien, vertreten vom Earl of Aberdeen, schloss am 3. Oktober einen weiteren Subsidienvertrag, der Österreich Zahlungen in Höhe von einer Million Pfund Sterling zusagte.
2.3 Bündnis im Krieg und Allianz für den Frieden
Die Teplitzer Vereinbarungen besiegelten den formellen Anschluss Österreichs an die russisch-preußische Koalition gegen Napoleon. In den letzten Septembertagen 1813 setzten die drei Alliierten ihre Truppen von Norden, Osten und Süden her Richtung Sachsen in Marsch; Napoleon fasste angesichts dieses Bedrohungsszenarios erst am 12. Oktober den Entschluss, seine Hauptkräfte bei Leipzig zu konzentrieren und seinen Hauptstoß gegen Schwarzenbergs Böhmische Armee zu richten.
Noch bevor es zur Konfrontation kam, wechselte der erste der Monarchen des Rheinbunds, König Max I. Joseph von Bayern, das Lager und schloss sich der Koalition an (Vertrag von Ried, 8. Oktober 1813). Gegen Zusage des Austritts aus dem Rheinbund und militärischer Hilfe für die Alliierten anerkannte Metternich den souveränen Status und die territorialen Interessen Bayerns.9 Tirol wurde sofort für militärische Operationen Österreichs geöffnet. Metternich versprach dafür, dem bayerischen König zu einer angemessenen Entschädigung für eventuelle Gebietsabtretungen zu verhelfen. Zwischen Anfang November und Anfang Dezember folgten die Souveräne von Württemberg, Hessen-Darmstadt, Baden, Nassau und Hessen-Kassel dem bayerischen Beispiel und wechselten durch vertragliche Absprachen auf die Seite der Gegner Napoleons. [<<25]
Mit dem Sieg der alliierten Truppen in der „Völkerschlacht“ bei Leipzig (16.–19. Oktober 1813) waren die bisherigen Kriegsziele der Koalition erreicht. Napoleon zog seine Truppen über Erfurt und Frankfurt Richtung Westen ab, fügte bei Hanau noch dem bayerischen Armeekorps unter General Wrede eine schwere Niederlage zu (30./31. Oktober), setzte Anfang November mit 80.000 Soldaten bei Mainz über den Rhein und ließ, zurück in Saint-Cloud, die Aushebung einer neuen Armee von 300.000 Mann anordnen.
Mit der Niederlage von Leipzig und dem Ende des Rheinbundes war Napoleons Hegemonie östlich des Rheins zusammengebrochen und damit jene Dispositionsfreiheit hergestellt, die die Verwirklichung der Absprachen von Kalisch, Reichenbach und Teplitz ermöglichte. Nun stellte sich die entscheidende Frage, ob man im Sinne der Maximalplanungen Zar Alexanders Napoleon in Frankreich angreifen sollte. Die Interessen des britischen Allianzpartners wiesen in diese Richtung, denn noch vor Leipzig, am 7. Oktober, hatte Wellington auf der iberischen Halbinsel den Grenzfluss Bidasoa in Richtung Frankreich überschritten. In den politisch-militärischen Zielen der Briten spielten im Sommer 1813 die Rückführung der angestammten Regenten von Spanien und Portugal sowie eine Vergrößerung und Stärkung der Niederlande als Barriere gegen Frankreich die wichtigste Rolle; dagegen wollten sie die Verhältnisse in Übersee aus eventuellen Verhandlungen völlig heraushalten. Vor allem aber drängte Außenminister Robert Viscount Castlereagh auf den Abschluss einer formellen Offensiv- und Defensivallianz zwischen Russland, Preußen, Schweden, Österreich und Großbritannien, um auf dieser Basis den Kampf gegen Napoleon fortzuführen.10
Читать дальше