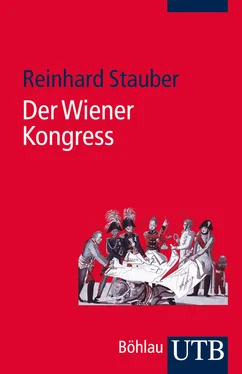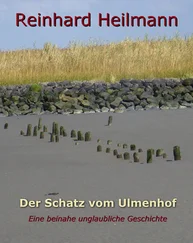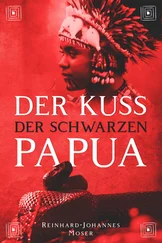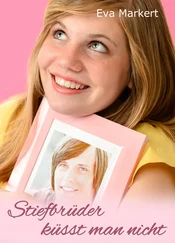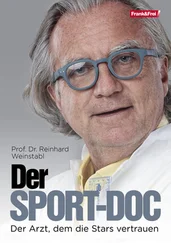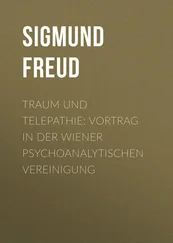Für Hilfe und Unterstützung bei der Erarbeitung des Buches danke ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Klagenfurt, vor allem Renate Kohlrusch, weiterhin Ingrid Groß, Florian Kerschbaumer, Marion Koschier, Walter Liebhart und Anton Zwischenberger.
Während der beiden letzten Jahre, als mich Dekanat und Manuskript doppelt in Beschlag nahmen, haben sich unsere Kinder Wolfgang und Magdalena ruhig und wie selbstverständlich auf den Weg in ihr eigenes Leben gemacht und sind mir gleichwohl als Ratgeber verbunden geblieben. Dafür bin ich dankbar. Und niemand schulde ich mehr Dank als meiner Frau. [<<10]
1. Einleitung – Schlüsselbegriffe zur „Wiener Ordnung“
In gängigen Lehrbüchern und Gesamtdarstellungen finden sich der Wiener Kongress und seine Wirkungsgeschichte häufig mit eingängigen Schlagworten verknüpft. Den Kontrast zu den revolutionären Ereigniskaskaden von 1789 und von 1848 hebt die bis in den Schulunterricht weit verbreitete, negativ konnotierte Wortmarke von der „Restauration“ hervor, für den deutschen Ereignisraum noch oft gekoppelt mit einem Epochensignum wie „Vormärz“ oder „Biedermeier“, beide „Inbegriff einer entpolitisierten Stillhaltekultur“.1 Die Hervorhebung des Prinzips der streng monarchisch definierten „Legitimität“ thematisiert ebenso wie die Debatte um den Erlass von Konstitutionen die neu zu findende Balance im Inneren der Staaten, die Realisierung eines Gleichgewichtssystems, die Etablierung einer stabilen Friedensordnung und der Streit um das Recht zur „Intervention“ in Drittstaaten das europäische System im Zeichen der fünf Großmächte. Einige dieser politischen Leitbegriffe zur Charakterisierung der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sollen in dieser Einleitung vorgestellt und kritisch hinterfragt werden.
Die Verwendung des Begriffs „Restauration“ als Epochenbezeichnung für die europäische Geschichte zwischen 1814/15 und 1848 „steckt voller Schwierigkeiten“ und ist nicht zu empfehlen.2 Die Bezeichnung ist einem [<<11] zeitgenössischen Titel der politischen Literatur entnommen, dem altständisch argumentierenden Werk „Restauration der Staats-Wissenschaft oder Theorie des natürlich-geselligen Zustands …“ des Berner Staatsrats Karl Ludwig von Haller, dessen erster Band 1816 erschien. Die Verwendung des Begriffs zieht immer den einschränkenden Hinweis nach sich, dass 1814/15 von „Restauration“ im Sinne „einer Rückkehr zu ‚vorrevolutionären‘ Verhältnissen auf breiter Front … keine Rede sein“ könne, womit der analytische Wert des Konzepts beträchtlich sinkt.3 Eine vollständige Wiederherstellung der alten, vorrevolutionären Ordnung wurde weder durchgeführt noch überhaupt angestrebt. Was die maßgeblichen Regierungen Europas nach einer Phase unvorhersehbarer politischer Entwicklungen seit 1789 erreichen wollten, war „die Wiederherstellung einer stabilen monarchischen Herrschaft unter veränderten Bedingungen.“4 Eine wichtige Rolle spielte dabei der Wille der leitenden Staatsmänner der „Generation Metternich“, nach über zwei Jahrzehnten Krieg überall in Europa, der nicht nur enorm kostspielig gewesen war, sondern auch zwischen drei und sechs Mio. Menschenleben gekostet hatte, endlich Frieden zu schaffen.5
„Restauration“ ist keiner der programmatischen Leitbegriffe der Verhandlungen des Wiener Kongresses; dort ist die Rede von „Restitution“, um die Rückkehr einer durch Umsturz vertriebenen Dynastie an die Herrschaft zu bezeichnen. Wenn man „Restauration“ als politischen Begriff für das nachnapoleonische Europa sinnvoll einsetzen will, dann weder im Sinne des konservierenden Einfrierens eines vorgestrigen Zustandes, noch gar als bewusstes „roll-back“ in Richtung Ancien Régime, sondern in Bezug auf einen Politikentwurf wie im Frankreich des Jahres 1814. Hier wurden dem revolutionären Prinzip zentrale politische Normen der vorrevolutionären Zeit entgegen gesetzt (und dabei die Prärogativrechte des Monarchen besonders betont), kombiniert aber mit der Anpassung an gewandelte Gegebenheiten der politischen Praxis, vor allem in der Bindung an eine Verfassung. Der Erlass der „Charte constitutionnelle“ Anfang [<<12] Juni 1814 bedeutete keineswegs eine Rückkehr zum Absolutismus, denn Frankreich war nun, wie schon 1791, eine konstitutionelle Monarchie mit einer modernen Repräsentativverfassung. Nicht im Inhalt, sondern in der Art des Erlasses per Oktroi und in der Hinzufügung einer Präambel zeigt sich der Anspruch Ludwigs XVIII. auf die ungeteilte Macht politischer Entscheidung, gestützt allein auf die monarchische Legitimität. Auf einer ähnlichen Herausstellung des monarchischen Prinzips, umwoben von einer christlichen Verbrüderungsrhetorik zwischen den Monarchen als Vertretern ihrer Völker, beruhte die Heilige Allianz vom September 1815. Die Blockade aller Entwicklungsmöglichkeiten und die Verteidigung des Status quo um seiner selbst willen wurden nirgends auf dem Kongress pragmatisch niedergelegt, sie sind eine Entwicklung der Jahre ab 1819.6 Auf dem Kongress einte alle maßgeblichen Akteure der Wille, eine stabile, berechenbare Neuordnung zu schaffen.
In aller Deutlichkeit ist darauf hinzuweisen, dass der harte Kern der Verhandlungen auf dem Wiener Kongress ein politisch-territorialer war: Es ging zunächst und vor allem um Machtpolitik, es ging um die Sicherung strategisch-militärischer Einflusszonen und günstige territoriale Konstellationen im Interesse der vier siegreichen Großmächte. Außer im Falle Polens gab es dabei einen bemerkenswert weitgehenden Grundkonsens: die Neugestaltung der Landkarte Europas in einer Gestalt, die neue Hegemonialversuche ausschloss.7 Die von den Briten verfolgte Eindämmung Frankreichs an seiner Ostgrenze durch eine Reihe verteidigungsbereiter Nachbarstaaten ist ein ebenso deutliches Indiz für diese geostrategischen Interessen wie Castlereaghs und Metternichs Bedenken gegen die Westverschiebung des Zarenreichs. Die Neubegründung Europas als politisches System 1814/15 beruhte stärker als bis dahin üblich auf kooperativen Strukturen und auf dem gemeinsamen politischen Ziel der Sicherung von Frieden und Ordnung. Die Methoden, die dazu während der knapp neun Verhandlungsmonate angewandt wurden, erinnerten allerdings eher an die Methoden des „Länderschacher[s]“ und die rein [<<13] auf Bevölkerungszahlen fixierte Ausgleichsarithmetik, nach denen im 18. Jahrhundert Friedensverträge gestaltet worden waren.8 Und durchaus häufig waren die Fälle, in denen die von Napoleon betriebene „Staatenzerstörung“ in Wien zugunsten jener Monarchen legitimiert wurde, die „dieses Zerstörungswerk als Profiteure überlebt“ und daraus für die Vergrößerung ihres Gebiets und die Zentralisierung ihrer Herrschaft Nutzen gezogen hatten.9
Legitimität, Recht, Gleichgewicht, Ordnung
Das „durch Tradition gehärtete Prinzip dynastischer Legitimität“ spielte in Wien eine zentrale Rolle;10 ins Spiel gebracht werden konnte es von den Bourbonen-Königen von Frankreich, Spanien und Neapel, die nie mit der Revolution oder Napoleon paktiert hatten. Die (keineswegs selbstverständliche) Durchsetzung der Rückkehr des Thronprätendenten Louis Stanislas aus dem angestammten Herrscherhaus nach Frankreich als Ludwig XVIII. ermöglichte es Talleyrand, auf dem Kongress „die monarchische Legitimität im allgemeinen zum Gegenprinzip gegen die Revolution zu erheben und dem Konzert der Mächte auf diese Weise einen Leitbegriff für seine Politik der Friedenssicherung an die Hand zu geben.“11
In dem wichtigen Schreiben Talleyrands an Metternich vom 19. Dezember 1814, das den Schulterschluss Österreichs und Großbritanniens mit Frankreich im Konflikt um Polen und Sachsen vorbereitete, sind die wichtigsten Programmbegriffe und Prinzipien der Kongresspolitik genannt. Von „Restauration“ ist nicht die Rede (lediglich vom „Werk der Wiederherstellung für ganz Europa“ („l’œuvre de la restitution … pour toute l’Europe“)), sehr wohl dagegen von der „Gerechtigkeit“ als „erste[r] Tugend“ („la vertu première est la justice“), von „Legitimität“ [<<14] („légitimité“), „Gleichgewicht“ („équilibre“) und der wichtigen Rolle des „öffentlichen Rechts Europas“ („le droit public de l’Europe“).12 In der Sicht Metternichs gehörten auch „Ruhe“ (als „erste[s] Bedürfniss[es] für das Leben und Gedeihen der Staaten“) und „Ordnung“ zu diesen Grundprinzipien. Der Staatskanzler qualifizierte sie in seinem um 1850 geschriebenen „Politischen Testament“ als zentrale Gegengewichte zu den von der Revolution entfesselten Freiheitsvorstellungen: „Nur auf dem Begriff von ‚Ordnung‘ kann jener der ‚Freiheit‘ ruhen.“13
Читать дальше