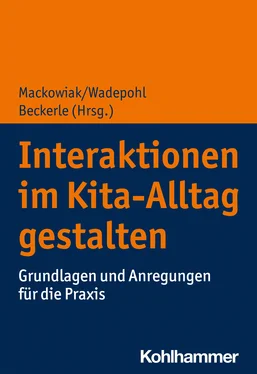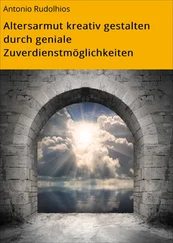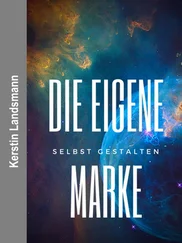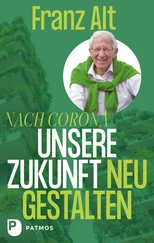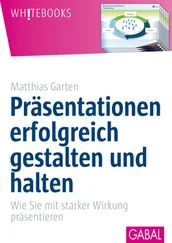In Kapitel 4 hebt Lichtblau die Bedeutung individueller Interessen von Kindern in lernunterstützenden Fachkraft-Kind-Interaktionen hervor. Neben der Unterscheidung zwischen situationalen und individuellen Interessen nimmt er eine inhaltliche Strukturierung kindlicher Interessen vor. Im Rahmen der Förderung liefert er Anregungen, wie kindliche Interessen erkannt und gefördert werden können. Dies gelingt sowohl über eine direkte als auch über eine indirekte inhaltliche Orientierung am individuellen Hauptinteresse des Kindes.
Beckerle, Linck und Bernecker beschreiben in Kapitel 5 Aufgaben und notwendige Kompetenzen frühpädagogischer Fachkräfte im Hinblick auf eine adaptive und alltagsintegrierte Sprachförderung. Sie stellen verschiedene Komponenten der Sprachförderdiagnostik vor und fokussieren hinsichtlich der alltagsintegrierten Sprachförderung einerseits das Sprachvorbild der Fachkraft, andererseits stellen sie eine Reihe von Sprachfördertechniken vor, die zum Erproben im Kita-Alltag einladen.
In Kapitel 6 thematisieren Schomaker und Hormann die Frage, wie Fachkräfte mit Kindern über Naturphänomene nachdenken, die kindlichen Vorstellungen und Annahmen erfassen und zu einer vertieften Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen Themen beitragen können. Dabei nutzen die Autorinnen konstruktive (Konzept-)Dialoge als eine Möglichkeit der Sichtbarmachung und (Weiter-)Entwicklung kindlicher, naturwissenschaftlicher Perspektiven.
In Kapitel 7 stellen Heinze, Feesche, Kula und Walter am Beispiel der Ernährungsbildung die Bedeutung gesundheitsförderlicher Fachkraft-Kind-Interaktionen vor. Dabei nehmen sie zum einen die Rolle der Fachkraft als Mittelsperson und Vorbild in den Blick, zum anderen geben sie Anregungen zur alltagsintegrierten Einbindung von ernährungsbezogenen Themen.
Hormann beschäftigt sich in Kapitel 8 mit der Arbeit in Lernwerkstätten in der Kita. Hierzu definiert sie die Begriffe der Lernwerkstatt und Lernwerkstattarbeit und stellt Besonderheiten der entwicklungsförderlichen Interaktionsgestaltung in dieser besonderen Lernumgebung heraus.
Auf die inklusionspädagogische Perspektive und die responsive Interaktionsgestaltung in heterogenen Lerngruppen geht Rothe in Kapitel 9 ein. Nach einer Begriffsklärung von Inklusion und Heterogenität wird ein Fallbeispiel ausführlich dargestellt, um das Zusammenspiel von Diagnostik und Förderung bei der Interaktionsgestaltung in Bezug auf die Dimensionen der Akzeptanz, Partizipation und Leistung abzubilden.
Anders, Y. (2013). Stichwort: Auswirkungen frühkindlicher institutioneller Betreuung und Bildung. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 16(2), 237–275.
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2018). Bildung in Deutschland 2018: ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu Wirkungen und Erträgen von Bildung. Bielefeld: wbv Media. Verfügbar unter: https://doi.org/10.3278/6001820fw.
Beckerle, C. & Mackowiak, K. (2019a). Sprachförderliche Interaktionsgestaltung im Kita-Alltag: Der Einsatz von Sprachfördertechniken in unterschiedlich komplexen Situationen. Sprachförderung und Sprachtherapie, 2(19), 108–113.
Beckerle, C. & Mackowiak, K. (2019b). Adaptivität von Sprachförderung im Kita-Alltag. Ein Vergleich des Sprachförderhandelns pädagogischer Fachkräfte bei Kindern mit Deutsch als Erst- und Zweitsprache und unterschiedlichen Sprachkompetenzen. Lernen und Lernstörungen, 8(3), 1–9.
Beckerle, C., Mackowiak, K., Koch, K., Löffler, C., Heil, J., Pauer, I. & von Dapper-Saalfels, T. (2018). Der Einsatz von Sprachfördertechniken in unterschiedlichen Settings im Kita-Alltag. Frühe Bildung, 7(4), 215–222.
Bruns, J. & Eichen, L. (2015). Adaptive Förderung zur Vorbereitung auf den Übergang vom Elementar- in den Primarbereich am Beispiel des Bereichs Mathematik. Frühe Bildung, 4(1), 11–16.
Fröhlich-Gildhoff, K., Nentwig-Gesemann, I. & Pietsch, S. (2011). Kompetenzorientierung in der Qualifizierung frühpädagogischer Fachkräfte (WiFF-Expertisen, Bd. 19). München: Deutsches Jugendinstitut.
Fröhlich-Gildhoff, K., Weltzien, D., Kirstein, N., Pietsch, S. & Rauh, K. (2014). Expertise: Kompetenzen früh-/kindheitspädagogischer Fachkräfte im Spannungsfeld von normativen Vorgaben und Praxis. Verfügbar unter: https://www.bmfsfj.de/blob/86378/67fa30384a1ee8ad097938cbb6c66363/14-experti se-kindheitspaedagogische-fachkraefte-data.pdf.
Fthenakis, W. E. (2009). Bildung neu definieren und hohe Bildungsqualität von Anfang an sichern. Betrifft Kinder, 9(3), 7–10.
Fuchs-Rechlin, K. & Smidt, W. (2015). Personalstruktur und Beschäftigungsbedingungen in Kindertageseinrichtungen. Frühe Bildung, 4(2), 63–70.
Hamre, B. K., Pianta, R. C., Downer, J. T., DeCoster, J., Mashburn, A. J. & Jones, S. M. et al. (2013). Teaching through interactions. Testing a developmental framework of teacher effectiveness in over 4,000 classrooms. The Elementary School Journal, 113(4), 461–487.
Hardy, I., Decristan, J. & Klieme, E. (2019). Adaptive teaching as a core construct of instruction. Journal for Educational Research Online, 11(2), 169–191.
Hasselhorn, M. & Kuger, S. (2014). Wirksamkeit schulrelevanter Förderung in Kindertagesstätten. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 17(2), 299–314.
Hormann, O. & Skowronek, M. (2019). Wie adaptiv ist der Einsatz von Sprachlehrstrategien in KiTas? Ergebnisse einer Videoanalyse. Frühe Bildung, 8(4), 194–199.
Kammermeyer, G., Roux, S. & Stuck, A. (2013). »Was wirkt wie?«. Evaluation von Sprachfördermaßnahmen in Rheinland-Pfalz. Abschlussbericht. Verfügbar unter: https://kita.rlp.de/fileadmin/kita/01_Themen/03_Sprachbild ung/Abschlussbericht.pdf.
Klieme, E., Lipowsky, F., Rakoczy, K. & Ratzka, N. (2006) Qualitätsdimensionen und Wirksamkeit im Mathematikunterricht: Theoretische Grundlagen und ausgewählte Ergebnisse des Projekts »Pythagoras«. In M. Prenzel & L. Allolio-Näcke (Hrsg.), Untersuchungen zur Bildungsqualität von Schule. Abschlussbericht des DFG-Schwerpunktprogramms (S. 127–146). Münster: Waxmann.
Kluczniok, K. & Roßbach, H.-G. (2014). Conceptions of educational quality for kindergartens. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 17(6), 145–158.
König, A. (2009). Interaktionsprozesse zwischen ErzieherInnen und Kindern. Eine Videostudie aus dem Kindergartenalltag. Wiesbaden: VS.
Kucharz, D., Mackowiak, K., Ziroli, S., Kauertz, A., Rathgeb-Schnierer, E. & Dieck, M. (Hrsg.) (2014). Professionelles Handeln im Elementarbereich (PRIMEL). Eine deutsch-schweizerische Videostudie. Münster: Waxmann.
Kuger, S. & Kluczniok, K. (2008). Prozessqualität im Kindergarten – Konzept, Umsetzung und Befunde. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 10(11), 159–178.
Lichtblau, M. (2018). Integrative Kindertageseinrichtung – inklusive Kindertageseinrichtung – eine Bestandsaufnahme im Jahr 2017. In M. Rißmann (Hrsg.), Didaktik der Kindheitspädagogik (Kita-Pädagogik, Bd. 3, S. 66–90). Köln: Carl Link.
Mackowiak, K., Kucharz, D., Ziroli, S., Wadepohl, H., Billmeier, U. & Bosshart, S. (2015). Anregung kindlicher Lernprozesse durch pädagogische Fachkräfte in Deutschland und der Schweiz im Freispiel und in Bildungsangeboten. In A. König, H. R. Leu & S. Viernickel (Hrsg.), Frühpädagogik im Aufbruch – Forschungsperspektiven auf Professionalisierung (S. 163–178). Weinheim: Juventa.
Nentwig-Gesemann, I., Fröhlich-Gildhoff, K., Harms, H. & Richter, S. (2011). Professionelle Haltung – Identität der Fachkraft für die Arbeit mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren (WiFF Expertisen 24). München: Deutsches Jugendinstitut.
Nentwig-Gesemann, I., Fröhlich-Gildhoff, K. & Pietsch, S. (2011). Kompetenzentwicklung von FrühpädagogInnen in Aus- und Weiterbildung. Frühe Bildung, 0, 22–30.
Papke, B. (2010). Bildung und Bildungspläne in der Elementarpädagogik – Chancen für Inklusion. Zeitschrift für Inklusion, 4(3). Verfügbar unter https://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/122/122.
Читать дальше