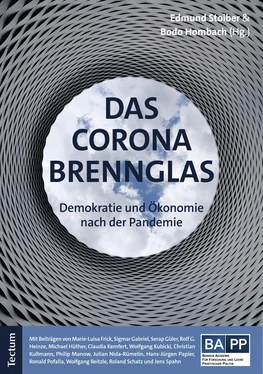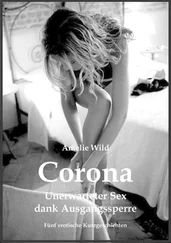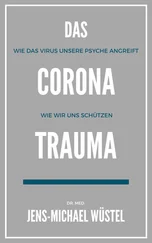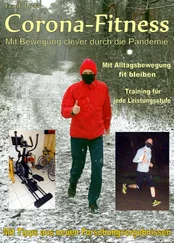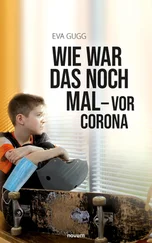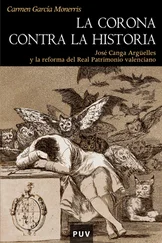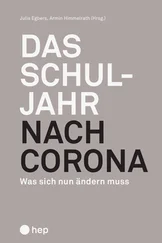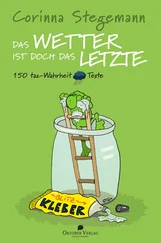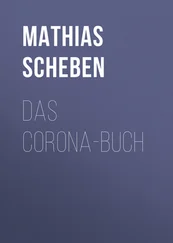Zu den Führungsaufgaben der Politik gehört deshalb, das Land und seine Bevölkerung auf die vor uns liegende Anstrengung vorzubereiten. Denn anstrengend wird es, wenn wir uns aus dieser Krise wieder herausarbeiten wollen. Auch hier legt Covid-19 unbarmherzig unsere Schwächen offen: Wir sind durch den Ausbau des individuellen Rechtsstaates politisch langsam geworden. Zudem ist unsere alternde Gesellschaft risikoaverser als unsere jüngeren Wettbewerber, die zudem auch nach Covid-19 „hungriger“ auf ein besseres Leben sein werden, als wir es in den gesättigten Demokratien noch sind. Hier ging es zuletzt schließlich eher um die post-ökonomische Frage statt um Aufstieg und Erfolg.
Es geht jetzt darum, die staatliche Hilfe auf jene zu konzentrieren, die es am härtesten trifft. Unterrichtsausfall ist für die Schülerinnen und Schüler, die mehr Zeit brauchen oder denen die Eltern nicht helfen können, eine echte Katastrophe. Und wer wenig verdient, für den sind 60 Prozent Kurzarbeitergeld zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel, denn die Miete und die Lebenshaltungskosten sinken ja nicht.
Das Motto sollte nicht lauten: „Gürtel enger schnallen“, sondern: „Ärmel hochkrempeln“. Die Null-Runde der Industriegewerkschaft Metall beim jüngsten Tarifabschluss zeigt, dass viele dazu bereit sind, wenn sie den Eindruck haben, dass es sich lohnt, beispielsweise zur Beschäftigungssicherung. Dazu gehört dann aber ein Lastenausgleich, wie ihn Westdeutschland ja nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sehr erfolgreich praktiziert hat. Die Idee war und ist, diejenigen, deren Wohlstand von der Krise nicht eingeschränkt wurde oder sogar gewachsen ist, an der Bewältigung der weltweiten Folgen der Krise zu beteiligen. Nur so verhindern wir, die enorm gestiegenen Staatsschulden allein durch Inflation und drastische Budgetkürzungen auffangen zu müssen, die auch die sozialen Sicherungssysteme schwächen würden.
Ein Ansatz könnte sein, endlich die Giganten der Digitalwirtschaft an der Finanzierung des Gemeinwohls zu beteiligen. Deren Gewinne werden bislang weitgehend privat abgeschöpft und nicht angemessen für das Gemeinwohl herangezogen. Aber auch die Erbschaftssteuer für die weiterhin sehr großen Vermögen, die in den kommenden Jahren vererbt werden, ist nach Auffassung vieler Ökonomen in Deutschland nach wie vor nicht gerecht ausgestaltet. Allerdings ist es mehr als dumm, dafür den Namen „Reichensteuer“ zu benutzen. Mit Sozialneid-Debatten hält man das Land nicht zusammen und fördert nicht das Verständnis, dass wir nur dann als Gesellschaft beieinanderbleiben, wenn alle in zumutbarer Weise dazu ihren Teil beitragen.
Dieser Teil wird eine Zeitlang bei jedem höher sein als bisher – bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die auf Lohnerhöhungen verzichten oder auf Kurzarbeiter- oder Arbeitslosengeld angewiesen sind; bei Lehrerinnen und Lehrern, die ausgefallenen Unterricht nachholen müssen; bei aufgeklärten Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes, die selbst frei von wirtschaftlichen Sorgen sind, die denen ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürgern aber nicht gleichgültig gegenüberstehen. Covid-19 zeigt uns so oder so, wie es um uns in Wahrheit bestellt ist.
Neue Sachlichkeit – Verschwindet der Populismus?
von Philip Manow
1. Einleitung
Wird zu den prominenten Opfern der Pandemie ein zuletzt um sich greifender Politikstil oder Politikertyp gehören, dessen Unfähigkeit zu verantwortlichem Krisenmanagement – aufgrund von Faktenferne, polarisierender Kommunikation und seinem Programm, „die Regierung zu dekonstruieren“ (Steve Bannon) – Covid-19 gnadenlos offenlegt (Kavakli 2020)? Wird sich also das Virus in der Lage zeigen, „den Populismus zu töten“ (English 2020; Mudde 2020; Müller 2020)? Oder werden – ganz im Gegenteil – die erheblichen wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen der Corona-Krise, genau wie sie es bereits in vorhergehenden Krisen getan haben, einen für einen polarisierenden Politikstil besonders förderlichen Kontext schaffen? Werden sie gesellschaftliche Spaltungen vertiefen, die sich dann erfolgreich populistisch bewirtschaften lassen?
Blickt man nur auf die bundesdeutschen Verhältnisse, so schienen sie lange Zeit dem ersten Szenario Plausibilität zu verleihen: Mit Beginn der Corona-Krise waren die Zustimmungswerte für die CDU und die Kanzlerin sprunghaft angestiegen, wohingegen die AfD in den Wahlumfragen stetig absackte. Aber das je länger, desto stärker erodierende Vertrauen in die Corona-Politik der Regierung zeigt, dass das politische Geschehen nicht weniger „dynamisch“ ist als das der Pandemie selbst. Und auf den ersten Blick zeigt auch der internationale Vergleich ein sehr uneinheitliches Bild: Donald Trump wurde – wesentlich auch wegen seines Versagens in der Corona-Krise – im November 2020 abgewählt, bekam aber mit 74 Millionen Stimmen mehr als Barack Obama bei seinem Erdrutschsieg im Jahr 2008. Und in Frankreich erscheint es neuen Umfragen zufolge als wahrscheinlich, dass vor allem aufgrund der hohen Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der Corona-Politik der Regierung (CEVIPOF 2021) Marine Le Pen vom rechtspopulistischen Rassemblement Nationale auch 2022 wieder in die zweite Runde der französischen Präsidentschaftswahlen einziehen wird, die sie – Stand heute – sogar gute Chancen zu gewinnen hat. Zur gleichen Zeit hat in Italien ein „governo misto“ (eine „gemischte Regierung“) aus Vertretern so gut wie aller italienischer Parteien (inklusive der im Sommer 2019 aus der Regierung ausgeschiedenen Lega) und Experten die von dem linkspopulistischen Movimento Cinque Stelle geführte Koalition abgelöst – unter dem Vorsitz des ehemaligen Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi.
Der Blick über den bundesdeutschen Kontext hinaus verlangt zumindest für Europa den Populismus auch als länderübergreifendes, europäisiertes Phänomen zu verstehen, bei dem der Populismus in dem einen Land nicht zu denken ist ohne den Populismus in dem anderen. Und da sich die populistischen Bewegungen in Europa, bei allen Unterschieden, in ihrer jeweiligen Europaskepsis komplementär treffen (Hooghe/Marks 2017; Manow 2018), etwa als linkspopulistische Kritik an der „vom Norden“ oktroyierten Austerität oder als rechtspopulistische Polemik gegen die fiskalische Unverantwortlichkeit „des Südens“, weitet sich das zu der Frage, inwiefern sich die Pandemie auch in eine grundsätzliche Krise der EU transformieren könnte. Auch hier sind zwei grundverschiedene Entwicklungsszenarien denkbar: zum einen die Desintegration aufgrund wachsender und dann auch noch politisch verstärkter wirtschaftlicher Divergenzen und der Asymmetrie des Schocks oder zum anderen die Krise als Gelegenheit zur weiteren „Vertiefung“ – im Bewusstsein dessen, dass sich die Geschichte der europäischen Integration als Abfolge von Vereinigungskrisen schreiben lässt (Patel 2018). Hinzu kommt, dass die Grenzschließungen und nationalen Alleingänge bei der Beschaffung medizinischer Materialien in der Frühphase der Pandemie sowie die gravierenden Probleme bei der europäischen Impfstoffbeschaffung im Spätherbst 2020 in der öffentlichen Wahrnehmung eine besonders positive und wichtige Rolle der Europäischen Union in der Bekämpfung der Corona-Epidemie und ihrer Folgen nicht etablieren konnten.
Für alle diese Szenarien ist allerdings von Bedeutung, dass sich die zuletzt in kurzen Abständen aufeinander folgenden Krisen Europas wirtschaftlich und politisch überlagern. Denn mit einer erstaunlichen Gesetzmäßigkeit wird Europa zuletzt in exakten 5-Jahres-Abständen von Krisen erschüttert, die das europäische Integrationsprojekt jeweils grundsätzlich herausfordern. Als der griechische Premierminister George Andrea Papandreou am 23. April 2010 vor pittoresker Inselkulisse in der Ägäis erklärte, Griechenland werde nun um Finanzhilfe bei seinen europäischen Partnern nachsuchen müssen, weil dem Land auf den internationalen Finanzmärkten der Zugang zu weiteren Krediten verwehrt sei, markierte dies den Moment, an dem sich die internationale Finanzkrise im Zuge des Bankrotts von Lehman Brothers in die Eurokrise transformierte (Baldwin/Giavazzi 2015; Mody 2018; Tooze 2018). Fünf Jahre später, im August und September 2015, war das Drama um die am Budapester Bahnhof gestrandeten Flüchtlinge der Beginn der europäischen Migrationskrise 1– die der aus der Eurokrise herrührenden Nord-Süd-Spaltung eine tiefgreifende politische Ost-West-Spaltung hinzufügen sollte. Weitere fünf Jahre später, zwischen Ende Januar und März 2020, von Land zu Land mit leichter zeitlicher Versetzung, brach in Europa das Coronavirus massenweise aus und traf auf Länder, deren politische, ökonomische und soziale Situation von den Nachwirkungen der zwei Vorgängerkrisen in jeweils spezifischer Form geprägt war.
Читать дальше