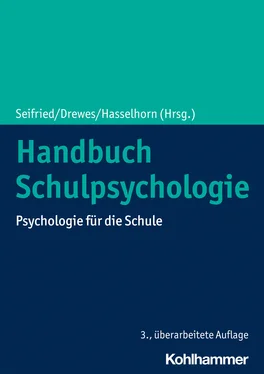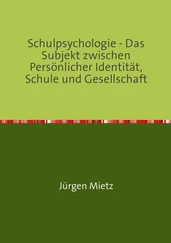Kevin bekommt bei Konflikten mit Mitschülern, bei Kritik und Einschränkungen durch die Klassenlehrerin massive Wutanfälle und tobt. Er ist in die Klasse nicht mehr zu integrieren und wird deshalb vorübergehend vom Unterricht suspendiert. Auch vom Hortbesuch wird Kevin ausgeschlossen. In Absprache zwischen Schulpsychologie, Schulaufsicht und Jugendamt besucht Kevin daraufhin ein Tagesgruppenprojekt.
Die Tagesgruppe Feuerwache ( https://www.tannenhof.de/kinderhilfe/tagesgruppen-feuerwache/, Zugriff am 11.05.2021) ist ein Schulersatzprojekt, das als sozialpädagogisches Gruppenangebot eines freien Trägers in Kooperation mit zwei Grundschulen organisiert und durch das Jugendamt und Lehrerstunden der Schulaufsicht finanziert wird. In Kleingruppen werden hier Kinder für maximal zwei Jahre pädagogisch-psychologisch betreut, bis sie wieder eine Regelschule besuchen können. Die Betreuung ist ganztags und schließt eine intensive Elternarbeit mit ein.
In der Tagesgruppe arbeiten Sonderpädagogen, Erzieherinnen und eine Therapeutin. Für die Aufnahme sind sonderpädagogischer Förderbedarf im Bereich Emotionale und soziale Entwicklung und ein schulpsychologisches Gutachten erforderlich.
5.9 Fazit: Ein Beratungszentrum statt vieler Institutionen und Helfer
Häufig besprechen Eltern »ihr Problem« mit dem Klassenlehrer, dann mit der Sonderpädagogin, dann mit dem Schulpsychologen, dann mit der Sozialarbeiterin im Jugendamt, dann mit dem Psychologen der Erziehungsberatung oder einer niedergelassenen Psychotherapeutin ….
Notwendig sind regionale Beratungszentren, in denen Schulpsychologie, Sonderpädagogische Förderzentren, Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst, Erziehungsberatung und der Sozialpädagogische Dienst des Jugendamtes zusammenarbeiten. Ratsuchende haben dann nur noch eine Anlaufstelle. Die Kooperation der Helfer wird vereinfacht und Doppelberatungen werden vermieden. Gut funktionierende Beispiele hierfür gibt es im In- und Ausland. Von großer Bedeutung ist dabei, dass in Kooperationsverträgen Aufgaben und Kompetenzen der beteiligten Institutionen klar definiert und abgegrenzt werden.
Bamberger, G. (2015). Lösungsorientierte Beratung: Praxishandbuch. Weinheim: Beltz
Behörde für Schule und Berufsbildung Hamburg (2014). Regionale Bildungs- und Beratungszentren (ReBBZ). Zugriff am 11.05.2021 unter www.hamburg.de/rebbz
Beschluss der Kultusministerkonferenz und der Jugendministerkonferenz der Länder (2004). Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe zur »Stärkung und Weiterentwicklung des Gesamtzusammenhangs von Bildung, Erziehung und Betreuung«. Zugriff am 11.05.2021 unter https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_06_04_Zusammenarbeit_Schule_Jugendhilfe.pdf
Grewe, N. (2015). Praxishandbuch Beratung in der Schule. Köln: Carl-Link.
Gudjons, H. (2006). Neue Unterrichtskultur – veränderte Lehrerrolle. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
Henschel, A., Krüger, R. & Schmitt, W. (Hrsg.) (2008). Jugendhilfe und Schule. Handbuch für eine gelingende Kooperation. Verlag für Sozialwissenschaften.
KMK (2020). Empfehlungen der Kultusministerkonferenz und der Jugend- und Familienministerkonferenz »Entwicklung und Ausbau einer kooperativen Ganztagsbildung in der Sekundarstufe I«. Zugriff am 11.05.2021 unter https://www.ganztagsschulen.org/de/40141.php
Lempp, R. & Rauschenbach, T. (2005). Die seelische Behinderung bei Kindern und Jugendlichen als Aufgabe der Jugendhilfe: Paragraph 35 a SGB VIII (5. Aufl.). Stuttgart: Boorberg.
Lindemann, H. (2020). Systemisch-lösungsorientierte Gesprächsführung in Beratung, Coaching, Supervision und Therapie: Ein Lehr-, Lern- und Arbeitsbuch für Ausbildung und Praxis. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Marburger, H. (Hrsg.). (2019). SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe (13. Aufl.). Regensburg: Walhalla.
Schnebel, S. (2017). Professionell beraten: Beratungskompetenz in der Schule. Weinheim: Beltz.
Schmitz, L. (2020). Gut beraten in der Schule: Ein Praxisbuch. Dortmund: Verlag modernes lernen.
Senatorin für Bildung und Wissenschaft Bremen (Hrsg.). (o. J.). Schulen im Reformprozess. Gründung und Aufbau regionaler Beratungs- und Unterstützungszentren. Konzept ReBUZ. Zugriff am 18.05.2021 unter https://www.begabungslotse.de/sites/default/files/specials_subpage/downloads/Konzept_ReBUZ_Bremen.pdf
Sekretariat der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder (Hrsg.). (1994–2021). Empfehlungen zu den Förderschwerpunkt Hören, Sehen, körperlich-motorische Entwicklung, Geistige Entwicklung, Sprache, Lernen, Emotionale-soziale Entwicklung, Autismus. Zugriff am 18.05.2021 unter https://www.kmk.org/dokumentation-statistik/beschluesse-und-veroeffentlichungen/bildung-schule/allgemeine-bildung.html#c1315
Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung (Hrsg.). (2008). Kooperation von Schule und Jugendhilfe zum Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit Schwierigkeiten in der emotionalen und sozialen Entwicklung. Berlin. Zugriff am 11.05.2021 unter https://www.berlin.de/sen/bjf/suche.php?q=Kooperation+Schule+Jugend
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin (Hrsg.). (2019). Qualitäts- und Handlungsrahmen der SIBUZ. Schulpsychologische und Inklusionspädagogische Beratungs- und Unterstützungszentren (SIBUZ). Zugriff am 18.05.2021 unter https://www.berlin.de/sen/bildung/unterstuetzung/beratungszentren-sibuz/
Senatsverwaltung für Bildung, Familie und Jugend (2019). Kooperationsvereinbarung zum Einsatz einer Koordinierungsstelle zur Umsetzung und Fortschreibung des bezirklichen Rahmenkonzeptes zur Kooperation von Schule und Jugendhilfe. Zugriff am 11.05.2021 unter https://www.berlin.de/sen/bjf/suche.php?q=Kooperation+Schule+Jugend
Shazer, S. & Dolan, Y. (2020). Mehr als ein Wunder: Lösungsfokussierte Kurztherapie heute. Heidelberg: Carl Auer.
SGB – Sozialgesetzbuch mit Sozialgerichtsgesetz. Bücher I–XII. (49. Aufl., 2020). München: C. H. Beck.
Senatsverwaltung für Gesundheit/Senatsverwaltung für Bildung (Hrsg.). (2003). Kooperation von Kinder- und Jugendpsychiatrie, Jugendhilfe und Schule. Berlin.
Wiesner, R. & Wapler, F. (Hrsg). (2021). SGB VIII: Kinder- und Jugendhilfe. München: C. H. Beck.
1Dieser Abschnitt entstand in Zusammenarbeit mit Dr. Ursula Mohn-Kästle, der ehemaligen Leiterin des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes Tempelhof-Schöneberg in Berlin.
2Der Text wurde von Dr. med. Ute Mendes erarbeitet, der Leiterin des SPZ im Vivantes-Klinikum Berlin-Friedrichshain.
3Dieser Abschnitt entstand in Zusammenarbeit mit Marco Heinrichsdorff, dem Leiter der Erziehungs- und Familienberatungsstelle Tempelhof-Schöneberg in Berlin.
4Dieser Abschnitt entstand in Zusammenarbeit mit Rainer Schwarz, dem Leiter des Jugendamtes Tempelhof-Schöneberg in Berlin.
6 Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung in der Schulpsychologie
Alexa von Hagen, Bettina Müller und Stephan Jeck
6.1 Grundlagen der Qualitätssicherung
6.2 Besonderheiten bei der Bestimmung der Qualität schulpsychologischer Arbeit
6.3 Sicherung und Entwicklung der fachlichen Qualität schulpsychologischer Arbeit
6.4 Aktuelle Entwicklungen zur Qualitätsorientierung in der Schulpsychologie: Zusammenfassung und Ausblick
Literatur
6.1 Grundlagen der Qualitätssicherung
»Den Fokus auf Qualität zu legen, ermöglicht es sicherzustellen, dass limitierte Ressourcen effizient und wirksam eingesetzt werden. Ohne Qualität kann es kein Vertrauen in die Effektivität des Systems geben« (WHO, 2003, S.viii).
Durch Maßnahmen der Qualitätssicherung sollen Arbeitsstrukturen, -prozesse und in der Folge die Leistungen und Ergebnisse von Organisationen kontinuierlich angepasst und weiterentwickelt werden (Donabedian, 2002). Dies trifft auch auf das Tätigkeitsfeld der Schulpsychologie zu, in dem kontinuierliche Qualitätssicherung und -weiterentwicklung der Beratungstätigkeit dazu dienen, bestmögliche Ergebnisse in der Unterstützung von Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrkräften, Schulleitungen und anderen schulrelevanten Personen zu erzielen (BDP, 2014). Wissenschaftliche Erkenntnisse über die Wirksamkeit bestimmter Methoden, Beratungsansätze und Verfahren aus verschiedenen Bereichen der Psychologie spielen dabei eine zentrale Rolle, da sie als Handlungsgrundlage der praktischen Arbeit von Schulpsychologinnen und Schulpsychologen verstanden werden (BDP, 2014; Kratochwill & Shernoff, 2004).
Читать дальше