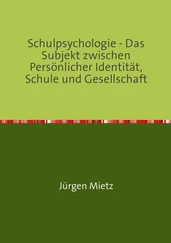Nur selten sind Lern- oder Verhaltensprobleme von Kindern und Jugendlichen von familiären oder schulischen Problemen und Konflikten zu trennen, mitunter bedingen sie sich gegenseitig. Daher ist eine enge Kooperation von Jugendhilfe und Schule notwendig. Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe wird in den Schulgesetzen der Bundesländer, von der Kultusministerkonferenz (KMK, 2004) und im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) gefordert, aber in der Praxis sehr unterschiedlich vollzogen. In vielen Bundesländern sind für Schule und Jugendhilfe noch verschiedene Ministerien, in den Gemeinden verschiedene Dezernate zuständig. Positive Beispiele für eine enge Kooperation von Jugendhilfe und Schule finden sich inzwischen jedoch in vielen Städten und Gemeinden. Kommunen arbeiten sozialräumlich und versuchen so, auf lokaler, lebensweltorientierter Ebene gemeinsam mit den örtlichen Schulen den Lebensraum bildungsfreundlich und inklusiv zu gestalten.
Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) unterscheidet folgende Hilfen in familiären Belastungs-, Not- oder Krisensituationen (§ 27–35):
• Ambulante, familienunterstützende Hilfen
− Soziale Gruppenangebote
− Erziehungshilfe (Erziehungsbeistand, Betreuungshilfe und Einzelbetreuung)
− Familienhilfe
− Ambulante Psychotherapie
• Teilstationäre, familienergänzende Hilfen
− Tagesgruppen
• Stationäre, familienersetzende Hilfen
− Unterbringung in einer Pflegefamilie
− Stationäre Heimunterbringung und betreute Wohnformen (Einzelwohnen, Wohngemeinschaften)
− Therapeutische und Wohnformen für besondere Problemlagen
− Mutter-Vater-Kind-Einrichtungen
Dieser Katalog ist nicht abgeschlossen (§ 27 SGB VIII). So werden in wachsendem Maße flexible Hilfen angeboten, die in Umfang und Form nach den jeweiligen erzieherischen Bedarfen ausgestaltet sind. Hinzu kommen Hilfen, die für junge Menschen mit einer seelischen Beeinträchtigung (oder die bedroht sind, eine solche zu erleiden) nach den Vorgaben des SGB IX geleistet werden (Rehabilitationsleistungen).
• Indikationen
− Steht ein »familiärer oder sozialer Erziehungsmangel« im Vordergrund, so kommen Hilfen zur Erziehung nach § 27 KJHG in Betracht. Ein schulpsychologisches Gutachten mit Diagnose und Empfehlung ist hilfreich. Antragsteller sind die Eltern.
− Besteht oder droht eine »seelische Behinderung«, so sind Eingliederungshilfen nach § 35a KJHG indiziert, um eine Teilhabeeinschränkung zu verhindern. In diesem Fall bedarf es in einigen Bundesländern neben dem psychologischen Gutachten einer ärztlichen Stellungnahme, um eine Erkrankung im Sinne der Gesetzlichen Krankenversicherung (SGB V) und damit eine Kassenleistung auszuschließen. Anspruchsberechtigt ist in diesem Falle das Kind.
Eine Abgrenzung dieser beiden Indikationen ist in der Praxis schwierig und sollte in Absprache mit dem zuständigen Jugendamt erfolgen (Wiesner & Wapler, 2011; Lempp & Rauschenbach, 2005). Dieses sollte dann ein formales Hilfeplanverfahren (gem. § 36 SGB VIII) mit den Personensorgeberechtigten unter Beteiligung der Schulpsychologie durchführen.
• Die Aufgabe der Schulpsychologie ist es,
− zu entscheiden, ob eine psychiatrische Erkrankung und Behandlung notwendig ist, und das Kind zum KJPD, zu entsprechenden Ärzten, Kliniken oder niedergelassenen Psychotherapeutinnen zu schicken;
− mögliche Jugendhilfeangebote zu kennen und in Kooperation mit dem zuständigen Jugendamt die Eltern, ihre Kinder, Lehrkräfte, Schulleitungen und Schulaufsicht fallbezogen darüber zu informieren;
− mit dem Jugendamt einen möglichen Jugendhilfebedarf zu prüfen, sich an der Hilfeplanung zu beteiligen und so die psychosoziale Versorgung für Schülerinnen und Schüler mit Lern- oder Verhaltensstörungen zu verbessern.
Die folgende Abbildung 5.3 zeigt am Beispiel einer ambulanten Psychotherapie die Überschneidung der Indikationen nach Erkrankung, Behinderung und Erziehungsbedarf sowie die verschiedenen Leistungsträger (Krankenversicherung, Kinder- und Jugendhilfegesetz, SGB VIII, IX und XII;  Abb. 5.3).
Abb. 5.3).

Abb. 5.3: Psychotherapie durch verschiedene Leistungsträger
Aufgabe des Jugendamtes ist auch der Schutz der Kinder vor Gefahren für ihr Wohl und für eine uneingeschränkte Entwicklung ihrer Persönlichkeit. Die Schule ist häufig der Ort, an dem Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung sichtbar werden. Schulverweigerung, Schuldistanz, Entwicklungsverzögerungen oder Verhaltensauffälligkeiten können Hinweise auf eine Gefährdung sein. Das Jugendamt berät in Fragen des Kinderschutzes und hat als die hier zuständige Fachbehörde weitgehende Interventionsbefugnis (Staatliches Wächteramt).
Diagnostik und Hilfeplanung
Die Planung von Hilfen zur Erziehung nach dem KJHG liegt in den Händen des allgemeinen Sozialpädagogischen Dienstes des Jugendamtes, das auch die Finanzierung übernimmt. Die Sorgeberechtigten, die Eltern oder die jungen Erwachsenen stellen bei der zuständigen Sozialarbeiterin oder dem Sozialarbeiter einen Antrag. Unter Einbeziehung aller Beteiligten wird eine Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII erarbeitet. Im Hilfeplan erfolgt eine formale Bedarfsfeststellung, die die Notwendigkeit und Eignung der Hilfen begründet. Die geplanten Hilfen sollen in den Lebenszusammenhang des Kindes (Familie, Schule, Hort) integriert werden. Entsprechende Entwicklungsziele und Handlungsschritte werden formuliert. Eine Grundvoraussetzung ist hierbei, zu klären, welchen Mitwirkungswillen die Familie ihrerseits zeigt und welchen Beitrag die Eltern und Kinder selbst leisten können. Zu oft noch werden gut gemeinte Hilfeangebote lediglich »konsumiert«, ohne dass Strukturveränderungen in der Familie oder der Schule stattfinden. Sind psychologische Diagnostik und Gutachten erforderlich, so werden vom Sozialpädagogischen Dienst die Fachdienste (Schulpsychologie, Erziehungsberatung, Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst) beauftragt, entsprechende fachgutachterliche Stellungnahmen zu erstellen. Die Schulpsychologie wird bei Lern- und Leistungsstörungen und bei Verhaltensstörungen beauftragt. In einigen Bundesländern können Schulpsychologinnen und Schulpsychologen aufgrund personeller Unterbesetzung diese Aufgaben nicht übernehmen und überlassen diese z. B. der Erziehungsberatung. Doch geben sie damit ein originäres Arbeitsfeld der Schulpsychologie als psychologischem Fachdienst auf.
5.6 Schulhilfekonferenzen – Schulpsychologinnen und Schulpsychologen als Moderatoren
Es macht wenig Sinn, einem Kind morgens in der Schule Förderunterricht zu geben, ohne zu berücksichtigen, ob am Nachmittag eine ausreichende Betreuung und Unterstützung z. B. bei den Hausaufgaben besteht. Es macht wenig Sinn, ein Kind am Nachmittag durch einen Familienhelfer betreuen zu lassen, ohne zu überlegen, ob das Kind nicht auch am Vormittag in der Schule eine Unterstützung braucht. Hier gilt es, in Schulhilfekonferenzen klare Absprachen im Sinne eines Fallmanagements zwischen allen Helferinnen und Helfern, sowie mit den Eltern und dem Kind zu treffen, um die personellen Zuständigkeiten und Betreuungsangebote (Schule, Freizeit, Familie) in ein Gesamtkonzept zu integrieren (  Abb. 5.4).
Abb. 5.4).
Читать дальше
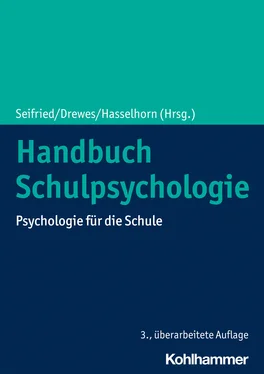
 Abb. 5.3).
Abb. 5.3).