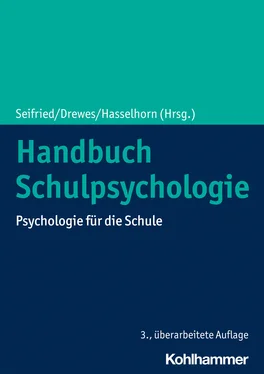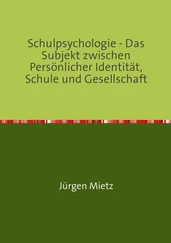Abb. 5.4: Schulhilfekonferenzen
Max besucht eine 3. Klasse. Er erhält aufgrund von auffälligem Verhalten in der Grundschule sonderpädagogische Förderung im Bereich Emotionale und soziale Entwicklung. Aus der Sicht des Schulpsychologen benötigt Max aber zusätzlich eine ambulante Psychotherapie.
Unter Vorsitz des Schulleiters findet eine Schulhilfekonferenz statt, in der Eltern, Klassenlehrerin, Schulpsychologe, Sonderpädagogin und die Sozialarbeiterin des Jugendamtes über die Förderung von Max gemeinsam beraten. Der Schulpsychologe begründet in einem Gutachten die Notwendigkeit der Psychotherapie. Das Jugendamt übernimmt auf Antrag der Eltern nach § 27 oder 35a KJHG die Kosten für die Psychotherapie in einer Psychologischen Praxis.
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen können helfen, Schule und Jugendhilfe besser zu verzahnen, die knappen Ressourcen effektiver einzusetzen und im Interesse der Klientinnen und Klienten ein Nebeneinander von Beratung und Jugendhilfe zu vermeiden. Sie verfügen über die professionelle Distanz, um aus einer neutralen und unabhängigen Position heraus, die Kooperation zwischen Schule und Jugendamt zu moderieren und zu koordinieren. Schulpsychologinnen und Schulpsychologen können die Schule über Angebote der Jugendhilfe informieren und die Schule für Jugendhilfemaßnahmen öffnen. Andrerseits können Schulpsychologen und -psychologinnen der Jugendhilfe einen Zugang zur Schule und ein Verständnis der Möglichkeiten und Grenzen von Unterricht und Erziehung in der Schule vermitteln. Schulintern können Schulpsychologinnen und Schulpsychologen Helferkonferenzen moderieren, in denen sich Klassenlehrer, Sonderpädagoginnen, Familienhelfer oder Psychotherapeutinnen und Eltern über gemeinsame Maßnahmen und Ziele verständigen.
Schulextern können Schulpsychologinnen und Schulpsychologen gemeinsam mit dem Jugendamt und den Eltern Betreuungsangebote in den verschiedenen Lebenswelten eines Kindes aufeinander abstimmen. Eine enge Kooperation zwischen Schulpsychologie, Kinder- und Jugendpsychiatrischem Dienst und Jugendamt (Erziehungsberatung und Sozialpädagogischem Dienst) ermöglicht die Abstimmung und Verzahnung der Hilfesysteme. Die Anzahl der Beraterinnen und Berater für eine Familie kann so auf ein Minimum reduziert werden.
Boris wirkt sehr zurückgezogen. Er hat kaum Kontakt zu Mitschülern, zeigt starke Ängste und ein massives Schulversagen. Er verweigert zunehmend den Schulbesuch. Die Mutter ist sehr ehrgeizig und möchte, dass ihre Söhne später »bessere« Berufe erlernen als ihr Mann, der Bauarbeiter ist. Boris’ großer Bruder besucht bereits das Gymnasium und ist dort ein guter Schüler. Boris wird von seiner Mutter durch eine massive Erwartungshaltung unter Druck gesetzt und durch stundenlanges Üben zu Hause überfordert. Nach einigen Beratungsgesprächen im Schulpsychologischen Beratungszentrum willigt die Mutter ein, sich vorübergehend um schulische Dinge nicht mehr zu kümmern. Boris erhält auf Antrag der Mutter vom Jugendamt einen Betreuungshelfer nach § 30 KJHG, der an drei Nachmittagen mit Boris spielt, die Spielplätze der Umgebung erkundet und auch Hausaufgaben betreut. Die Mutter und Boris fühlen sich entlastet und können schrittweise wieder eine positivere Beziehung aufbauen. Ein drohendes Schulversagen und eine manifeste psychische Störung konnten bei Boris verhindert werden. Die Schulpsychologin setzt die Beratungsgespräche mit der Familie fort und führt regelmäßige Fallbesprechungen mit dem Betreuungshelfer.
Sabrina war in der Grundschule eine gute Schülerin. Sie erhielt eine Gymnasialempfehlung. Doch in der 8. Klasse beginnt sie, erst stunden-, dann tageweise zu schwänzen. Ihre Leistungen werden schlechter. Sie wird nicht versetzt und wechselt die Schule. Die Eltern von Sabrina trennen sich. Sabrina und ihre ältere Schwester leben anfangs bei der Mutter, die jedoch nach der Trennung zunehmend Alkohol trinkt. Sabrina ist weitgehend sich selbst überlassen. Nach einem Konflikt mit einer Mitschülerin (Prügelei) geht sie schließlich nicht mehr zur Schule, jetzt schon seit eineinhalb Jahren.
In Beratungsgesprächen mit Sabrina und ihrer Schwester wird schnell deutlich, dass die Mädchen ein Zusammenleben mit ihrer Mutter nicht mehr wollen. Sie sind viel unterwegs, wohnen »mal hier, mal dort« und schlafen bis mittags.
In einer Schulhilfekonferenz wird den Mädchen von der Sozialarbeiterin des Jugendamtes »betreutes Einzelwohnen« angeboten.
Vom Berufsberater, der auch an der Konferenz teilnimmt, erhält Sabrina einen Platz in einer berufsvorbereitenden Maßnahme des Arbeitsamtes (Agentur für Arbeit). Hier kann sie den Schulabschluss nachholen.
Sabrina befindet sich im zehnten Schulbesuchsjahr und ist noch schulpflichtig. Daher erhält sie vom Schulrat eine zweckgebundene Befreiung von der Schulpflicht.
Der Schulpsychologe leitete diese Maßnahmen ein und koordinierte die Zusammenarbeit der verschiedenen Personen.
5.7 Lerntherapien als Jugendhilfemaßnahme
Obwohl das KJHG ein Bundesgesetz ist, sind uns in den verschiedenen Bundesländern und Gemeinden sehr unterschiedliche Interpretationen der juristischen und finanziellen Möglichkeiten von »Hilfen zur Erziehung« nach dem KJHG bekannt. Jedes Bundesland erlässt eigene Ausführungsvorschriften. So werden z. B. in einigen Bundesländern von den Jugendämtern Lerntherapien bei Lese-Rechtschreib-Schwäche oder Rechenschwäche finanziert, während sie andernorts abgelehnt werden.
Karin besucht die 4. Klasse einer Grundschule und hat große Rechtschreibschwierigkeiten. Die Mutter erzählt, dass es eigentlich in allen Fächern Probleme gibt, weil Karin in letzter Zeit schriftliche Arbeiten zunehmend verweigere.
Die Schule war von Anfang an ein Problem. Karin wiederholte die 1. Klasse in der flexiblen Schulanfangsphase und hatte trotz Förderunterricht nur mäßige Lernerfolge. Sie hat große Schwierigkeiten bei Diktaten. Die Mutter versucht, durch tägliches Üben Karin zu helfen. Dabei gibt es viele Konflikte. Karin wirkt traurig. Sie erzählt, dass sie am liebsten nicht mehr zur Schule gehen wolle.
Da alle schulischen Fördermöglichkeiten ausgeschöpft sind und ein generelles Schulversagen droht, empfiehlt die Schulpsychologin eine ambulante Lerntherapie. Die Eltern stellen Karin in einem Institut für Lerntherapie vor, dass den Kosten- und Behandlungsplan für eine LRS-Therapie erstellt. Die Schulpsychologin schickt diesen Kosten- und Behandlungsplan gemeinsam mit ihrem Gutachten an das Jugendamt, das auf Antrag der Eltern die Finanzierung der Lerntherapie nach § 35a KJHG übernimmt. Voraussetzung ist, dass eine seelische Behinderung droht und hierdurch die soziale Teilhabe eingeschränkt ist. Die Schulpsychologin führt begleitende Beratungsgespräche mit den Eltern und der Klassenlehrerin und empfiehlt, als Nachteilsausgleich die Benotung von schriftlichen Leistungen auszusetzen.
5.8 Kooperationsprojekte zwischen Schule und Jugendhilfe
Um die Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe zu entwickeln und die Ressourcen zu bündeln, sind regelmäßige Konferenzen mit der Leitung des Jugendamtes, der Erziehungsberatung, des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes, mit der Schulaufsicht und der Schulpsychologie notwendig, um grundsätzliche Ziele, Verfahrensweisen und Kostenschätzungen der Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe zu besprechen und zu entwickeln. So können gemeinsam finanzierte Tagesgruppen und Schulersatzprojekte aufgebaut werden, die Schulen entlasten und eine Stabilisierung von Kindern und Jugendlichen ermöglichen. Positive Beispiele finden sich in vielen Bundesländern und Gemeinden.
Читать дальше