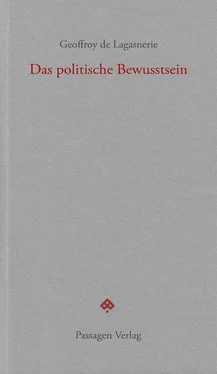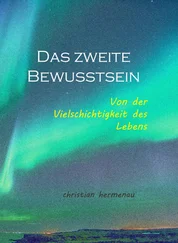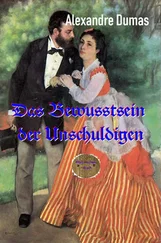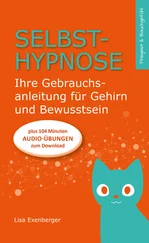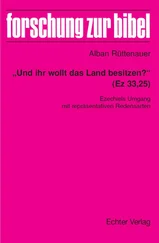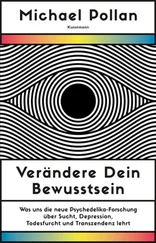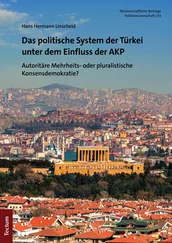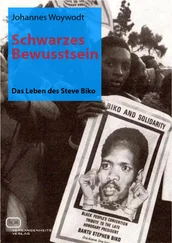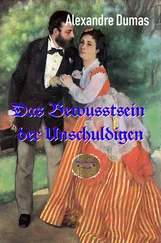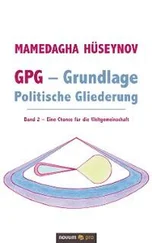Ist eine Revolution anders als im Modus der Rekonstitution möglich? Der Begriff der destituierenden Kraft dient dazu, diese Möglichkeit zu denken. Dem traditionellen Spiel der Politik setzt Agamben die Gestalt des Nichtstuns, der Niederlegung, der Blockade und der Aktion entgegen, die die politischen Beziehungen destituieren und absetzen würde, um uns in ein anderes Zeitalter zu führen.
In Wirklichkeit wiederholt dieses Projekt klassische Schemata. Die Vorstellung von konstituierender Kraft und destituierender Macht reaktiviert letztlich die Vorstellung, dass die Institutionen, in denen wir leben, auf subjektiven Grundlagen beruhen (als würde es, um sie zu destituieren, genügen, dass wir ihnen unsere Zustimmung entziehen), was im Grunde auf eine Neuformulierung der Vertragstheorie hinausläuft. Wichtiger ist aber, dass das, was Agamben in der Form des Kreislaufs von Konstitution und Vereinnahmung beschreibt, in der politischen Theorie immer als jener Prozess gedacht worden ist, in dem die „Volkssouveränität“ sich vom „Staat“ zurückzieht und die aktuelle „Regierung“ preisgibt, um eine neue zu konstituieren. Die Rechtstheorie wird geradezu von dem Problem heimgesucht, dass die Volkssouveränität ein Regime instituiert, aber die Möglichkeit behält, sich vom Staat zurückzuziehen und die aktuelle Regierung aufzugeben, um eine neue zu konstituieren. Und vielleicht lässt sich die Wirkung, die Agamben auf bestimmte Sektoren der sogenannten radikalen Politik ausübt – die weitgehend vom weißen Kleinbürgertum beherrscht wird und dessen paradigmatisches Beispiel das Unsichtbare Komitee ist –, dadurch erklären, dass seine Schriften konservativen Denkformen einen subversiven Anstrich geben, insofern sie sich damit begnügen, die traditionellste Reflexion in eine andere Sprache zu übersetzen – was das philosophische Äquivalent zur politischen Praxis jener Gruppen ist, die die bürgerlichen Formen des Weltbezugs als radikal ausgeben (Rückzug, Klassendünkel gegenüber Aktivismus und Gewerkschaften, Kleinunternehmertum, Lobeshymnen auf das wahre Leben im Gegensatz zur Perversität der modernen Welt und Technik).
Ausnahme und Bürgerkrieg: Was sich dem Gesetzten entzieht
Tatsächlich gibt es Augenblicke, in denen Agamben sich bewusst wird, dass Kategorien wie Volk, Verfassung, „wir“, Bürgerschaft, Legitimität, Souveränität und die Erzählungen, die ihnen zugrunde liegen, weit von der Realität entfernt sind. Doch statt auf sie zu verzichten, wird seine Reflexion zu einer Form des Nachdenkens über die Kluft zwischen der Wirklichkeit und diesen Kategorien, über ihre Nicht-Verwirklichung, ihre Unangemessenheit, ihre Unvollständigkeit. Man kann hierin die Bestätigung dafür zu sehen, dass wir es tatsächlich mit einer Logik zu tun haben, die man mythologisch nennen kann, weil sie kein Außen hat: Sie lässt sich von dem, was ihre Gültigkeit in Frage stellt, nicht erschüttern, es vermag nicht, ihre Entwicklung zu unterbrechen, sondern wird von ihr absorbiert.
Wahrscheinlich hat Agamben deshalb zwei Begriffe ins Zentrum seines Werks gestellt, die sich an der Grenze dessen befinden, was er die politische Sphäre nennt: den Ausnahmezustand und den Bürgerkrieg.
Ich möchte mich hier auf den „Bürgerkrieg“ beschränken. In seinen Analysen erklärt Agamben, dass er den Bürgerkrieg zum Gegenstand nimmt, weil er sich in einem „Bereich der Ununterscheidbarkeit zwischen dem unpolitischen Raum der Familie und dem politischen des Gemeinwesens“ 34befindet. Anders gesagt, der Begriff des „Bürgerkriegs“ ermöglicht es, die Aktions- und Beziehungsformen zu erfassen, die sich der Einteilung in politisch/privat und Gemeinwesen/Familie entziehen. Es geht um die Schwelle der Ununterscheidbarkeit, auf der das Politische und das Unpolitische zusammenfallen. Der Bürgerkrieg „markiert […] eine Schwelle der Ununterscheidbarkeit, vermittels deren das Unpolitische sich politisiert und das Politische ‚ökonomisiert‘“ 35. Hier liegt der wesentliche Punkt: Das Interesse an der Form des Bürgerkriegs führt Agamben dazu, zu erfassen, dass es letztlich keine politische Substanz gibt:
Die Politik ist ein Feld, das unablässig von den polaren Spannungen der Politisierung und der Entpolitisierung , der Familie und des Gemeinwesens durchzogen wird. Die Spannung zwischen diesen beiden entgegengesetzten Punkten, die voneinander getrennt und doch aufs engste verbunden sind, ist […] unauflöslich. 36
Die Frage, die sich nunmehr stellt, ist folgende: Welchen Nutzen hat es, Kategorien zu setzen, „die Politik“ und „die Familie“, polis und oikos einander entgegenzusetzen, wenn man im Anschluss feststellen muss, dass die Wahrheit sich ihnen entzieht, sodass es nötig ist, einen dritten Begriff hinzuzufügen (Bürgerkrieg), um die Wirklichkeit denken zu können? Anstatt davon zu sprechen, dass es nur Strömungen der Politisierung und Entpolitisierung gibt, die sich der „politischen Substanz“ nähern oder sich von ihr entfernen, ohne sie jemals vollends erreichen zu können, wäre es da nicht angemessener zu sagen, dass das, was Agamben „Politik“ nennt, nicht existiert und dass man besser andere – aussagekräftigere – Begriffe suchen sollte, um von dem zu sprechen, was existiert, anstatt sich damit zu begnügen, die Dinge unter dem Aspekt ihrer Nicht-Entsprechung mit einer Form zu charakterisieren, die – nicht existiert?!
2. Vom Monismus zum Reduktionismus
Man könnte die Sache folgendermaßen ausdrücken: Unser politisches Denken vollzieht sich im Modus einer Erkenntnisform und eines Diskussionsfeldes, die gerade in ihrer Konstitution die autonome Existenz von so etwas wie „die Politik“ voraussetzen. Die Autoren, die sich im Feld bewegen, das man „politische Philosophie“ nennt, unterscheiden sich in der Art und Weise voneinander, wie sie diese Autonomie konstruieren, wie sie sie fordern, welche Unterscheidungsmerkmale sie für die Politik im Hinblick auf Wirtschaft, Moral, Soziologie, Ethik usw. ausarbeiten … Diese Philosophie tritt immer dann auf, wenn ein Diskurs auf das Gesetz, den Staat oder auf uns selbst als Subjekte Bezug nimmt, indem er sich auf ein abstraktes Politikverständnis stützt. Das erklärt, warum dieser Diskurs seine eigenen Wörter hat, dass er über Begriffe verfügt, die nur in seinem Rahmen und in Bezug auf seine Gegenstände stichhaltig sind, die wir aber niemals für andere Aspekte unseres Daseins verwenden: Volk, Gemeinschaft, Souveränität, Demokratie, Bürger. Mit anderen Worten, es läuft alles so ab, als ob eine Art Zauber in der Welt wirkte und das „Soziale“ verschwände, wenn „die Politik“ erscheint. So, als ob in diesem Augenblick alles anders würde: Wir wären nicht mehr Individuen, die soziale Eigenschaften haben und von Interessen geleitet wären, sondern Bürger oder Vernunftwesen innerhalb eines Volks; die Sprache wäre kein Werkzeug innerhalb des Spiels der Herrschaft mehr, sondern ein Werkzeug der Diskussion; zwischenmenschliche Beziehungen wären keine Kräfteverhältnisse und keine kriegerischen Beziehungen mehr, sondern plötzlich interindividuelle Beziehungen der Diskussion und der Deliberation.
Doch warum sollten unsere Verhältnisse zum Staat und zum Gesetz von anderer Natur sein als unsere Verhältnisse zu anderen Institutionen des sozialen Lebens? Warum sollten die Machtbeziehungen, die sich im Staat und durch den Staat bilden, einer anderen Ökonomie unterliegen als andere Machtbeziehungen? Warum sollte unser Bezug zur Sprache von einem Zwangsverhältnis zu einem Deliberationsverhältnis werden, sobald wir „politische“ Themen behandeln oder rechtliche Überlegungen anstellen, wie Habermas 37manchmal anzudeuten scheint?
Wir alle stehen täglich in vielerlei Beziehungen zueinander. Alle diese Beziehungen sind durch Institutionen und symbolische Rahmenbedingungen vermittelt: Warum sollten sich die Modalitäten meiner Beziehungen zu anderen plötzlich ändern, wenn ich wählen gehe oder auf andere Weise politisch tätig werde? Aus welchen Gründen sollten sich die interindividuellen Beziehungen verwandeln, wenn sie etwas zum Gegenstand oder als Bühne hätten, das man „die Politik“ nennt? Die Zuordnung von Institutionen wie Wahl, Staat, Gesetz und Recht zu einem einzigen Bereich, der „die Politik“ hieße und der der „Politikwissenschaft“ oder der „politischen Philosophie“ unterläge, setzt voraus, dass diese Institutionen aus ein und derselben Logik hervorgehen. Doch inwiefern sollte das der Fall sein? Warum sollte die Wahl nicht dem Bereich des Unternehmens näherstehen als der Demonstration?
Читать дальше