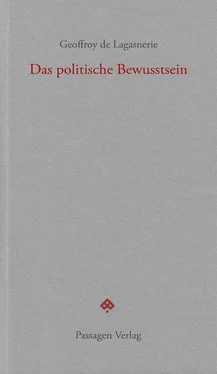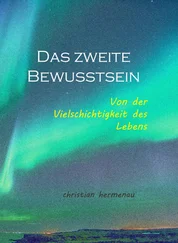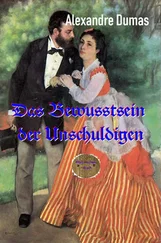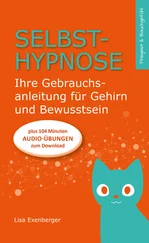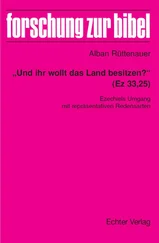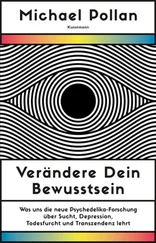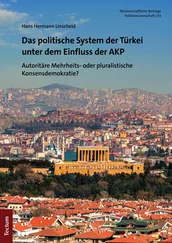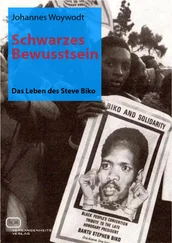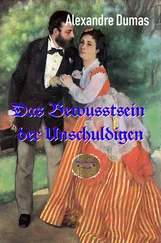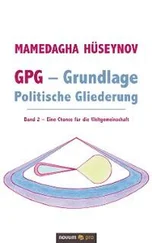Die Eingrenzung einer spezifischen Identität „der Politik“, die sich bei Carl Schmitt vollzieht, findet sich in fast homologen Formen bei Autoren, die ihm dessen ungeachtet radikal widersprechen. Man denke zum Beispiel an Jürgen Habermas, wenn er Max Weber in Faktizität und Geltung wegen seines „Soziologismus“ kritisiert. Weber leugne die spezifische, deliberative und rationale Dimension politischer Beziehungen, indem er die politischen Beziehungen in die sozialen Machtverhältnisse einschreibt. Habermas beschuldigt Weber, den Normativität des rationalen Rechts zu „untergraben“, insofern er das Recht auf nichtrechtliche Logiken und die Problematik des Staats auf die Herrschaftsproblematik reduziere. 28Man kann auch die Arbeiten von Chantal Mouffe und Ernesto Laclau erwähnen, die auf derselben Annahme gründen, nämlich dass die Politik keine Fortführung des Spiels der sozialen Kategorien sei. Die Konstruktion der Kategorie „Populismus“ wurzelt in der Überzeugung, dass eine politische Theorie kollektiver Identitäten die Einführung einer Realitätsebene voraussetzt, die sich von der Ebene sozialer Zugehörigkeiten und Kämpfe unterscheidet und dass die Konstruktion eines politischen Subjekts sich auf Operationen stützt, die sich von den Operationen der Konstruktion eines sozialen Subjekts oder einer sozioökonomischen Gruppe unterscheiden. Wer „politisch“ sagt, würde „Konstruktion einer Kollektividentität“, die jede feste soziologische Identität übersteigt, und würde somit Autonomie der politischen Logik und des politischen Wortschatzes gegenüber dem Sozialen sagen. 29
In Agonistik erkennt Chantal Mouffe übrigens an, mit Carl Schmitt darin übereinzustimmen, dass es notwendig ist, ein dem Politischen eigenes Regime zu denken. Sie behauptet ebenso, dass die Gesamtheit ihrer Theorie der radikalen Demokratie im Gegensatz zu den von Rawls oder Habermas angebotenen Demokratiemodellen steht, weil diese keine eigentlich politische Konzeption der politischen Verhältnisse böten, sondern eine ethische oder moralische. Mit anderen Worten, sie erhebt dieselbe Forderung wie Habermas und Rawls – nämlich die Politik auf nichts anderes als sie selbst zu reduzieren und ihre Besonderheit zu denken –, aber sie wendet diese Geste gegen Habermas und Rawls selbst, deren Werke ein unzureichendes Bild der Politik zeichneten, das ihrer Autonomie nicht gerecht würde. Es ist kein Zufall, dass das Buch Agonistik den Untertitel „ Die Welt politisch denken “ trägt. 30
Der Glaube an die Existenz einer der Politik spezifischen Ebene ist so prägend, dass sogar ein Autor wie Giorgio Agamben, dessen Projekt doch beansprucht, die Kategorien der Politik zu dekonstruieren, nicht daran denkt, sie in Frage zu stellen. Er stellt sie an den Anfangspunkt seiner Untersuchung. Ganz am Ende von L’uso dei corpi 31, dem Werk, das die zwanzigjährige Reflexion von Homo sacer abschließt, erinnert Giorgio Agamben daran, dass sein Ehrgeiz darin bestand, die Politik einer Archäologie zu unterziehen. Es handelte sich weder darum, diesen oder jenen politischen Begriff oder diese oder jene Institution zu kritisieren oder zu korrigieren, sondern das ans Licht zu bringen, was die Grundlage dieses Diskurs- und Praxisraums ausmacht. Agamben nennt das „die originäre Struktur der Politik“ 32freilegen. Doch diese Formulierung ist problematisch. Die Arbeit, die versucht, „das freizulegen, was die originäre Struktur der Politik bildet“, setzt die Existenz eines eigenen Bereichs – mit dem Namen „die Politik“ – voraus, dessen Abgrenzung im Vorhinein gegeben ist und dessen tatsächliches Bestehen und Umrisse Agamben nie in Frage stellt. Sicher, es gibt das Gesetz, es gibt den Staat, es gibt die Polizei, doch warum sollten unsere Beziehungen zu diesen Institutionen anderer Natur sein als unsere Beziehungen zu Unternehmen, zum Markt, zur Familie usw.? Warum sollten die Mächte, die sich in ihnen entfalten, eine andere Form haben als die, denen wir in anderen Sphären gegenüberstehen? Aus welchen Gründen sollten politische Beziehungen eine Singularität gegenüber allen interindividuellen und alltäglichen Formen darstellen?
Ich sage nicht, dass der Versuch, eine Unterscheidung zwischen dem Politischen und dem Nicht-Politischen zu machen, als solcher notwendigerweise illegitim sei und ein Projekt zum Irrtum verurteile (obwohl, wer weiß!). Aber diese Grenze kann nicht postuliert und als Grundlage, die die Entfaltung der rationalen Untersuchung vorprägt, vorausgesetzt werden. Die Rechtfertigung dieser Konstruktion muss notwendigerweise einen Bestandteil des Projekts ausmachen, denn sonst stutzt man sich die Welt auf ideologische Weise im Vorhinein zurecht und macht diese ideologische Voreinteilung, von der nichts garantiert, dass sie nicht auf einer Mystifizierung oder Illusion beruht, zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen.
Indem Agamben die Vorstellung eines eigenen Bereichs der Politik seinem Werk zugrunde legt, verurteilt er sein Denken dazu, sich von äußeren Elementen beeinträchtigen zu lassen. Trotz seines Ehrgeizes, die politische Sphäre und ihre Grundelemente zu objektivieren, bringt er mystische Bilder der Macht in Umlauf: Er verwendet Wörter und Begriffe, auf deren Gebrauch wir verzichten sollten. Das kommt besonders in seinem Buch über Hobbes und den Bürgerkrieg zum Ausdruck, wo er für die Beschreibung des Staats, des Gesetzes und der politischen Subjekte Kategorien wie „Menge“, „Volk“, „Verfassung“ oder „Souveränität“ benutzt, ohne sich über die Gültigkeit solcher Begriffe oder über ihre operativen Eigenschaften Gedanken zu machen. 33
Die Verwurzelung von Agambens Reflexion im traditionellsten Dispositiv der Theorie erklärt, warum sein Denken, anstatt „die originäre Struktur der Politik zu dekonstruieren“, im Gegenteil mit einem anderen Vokabular die klassischsten Wahrnehmungen fortschreibt. Agamben veranschaulicht exemplarisch, wie groß der Fluch ist, der auf uns lastet, wenn wir über Politik sprechen, und der sogar die Autoren, die kritische Verfahren zum Leben erwecken möchten, dazu führt, trotz allem Gefangene eines Wortschatzes, einer Sprache und einer Denkform zu bleiben, die problematisch sind, sowie eine mythologische Wahrnehmung der Tatsachen und eine mystifizierende Weise, über Institutionen zu sprechen, aufrechtzuerhalten.
L’uso dei corpi zum Beispiel endet mit dem Versuch, die Gestalt zu denken, die eine neue Art von politischer Aktion – Agamben nennt sie destituierend – annehmen könnte. Er behauptet, dass die politische Aktion weitgehend im Modus der konstituierenden Macht gedacht und praktiziert worden ist. Politisches Handeln bedeutet Konstituieren einer Macht. Doch diese Art der Konstitution beinhaltet auch, dass die Macht die Kraft der sie konstituierenden Aktion vereinnahmen wird, damit die Aktion nicht die Möglichkeit hat, sich der Macht zu entziehen, sie aufzulösen oder etwas anderes zu konstituieren – sodass diese Kraft sich im Augenblick ihrer Erfüllung von sich selbst trennen wird. Die Revolution, in deren Verlauf die konstituierende Kraft sich von der konstituierten Macht zurückzieht, stelle demgegenüber den umgekehrten Vorgang dar. Agamben versucht, eine politische Aktion zu denken, die dem Konstitutionskreislauf entkommt. Er ruft zur Ausarbeitung einer Aktionsform auf, die sich in Form einer destituierenden Kraft dort entfaltet, wo die Revolution als Rückzug und Rekonstitution, als Disartikulation und Reartikulation uns in Vereinnahmungszyklen einsperrt: Anstatt mit dem zu brechen, wogegen sie sich wendet, führt sie instituierte Formen fort und reproduziert den Teufelskreis von Konstitution, Aneignung der konstituierenden Kraft und Notwendigkeit einer neuen Konstitution.
Читать дальше