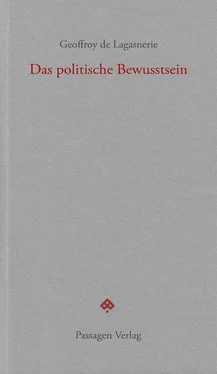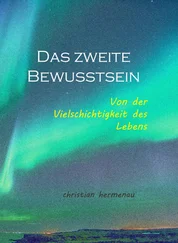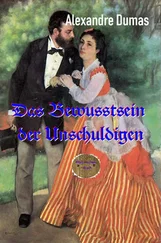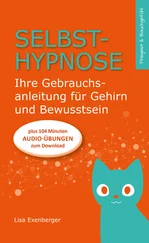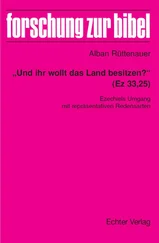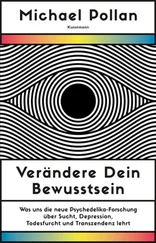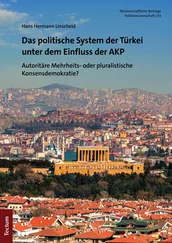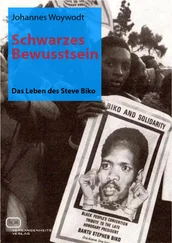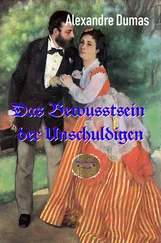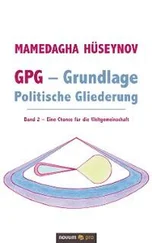Die zweite mögliche Form der Einrichtung einer politischen Bindung nimmt nicht die Form des gegenseitigen Vertrags an. Sie entstammt dem Krieg, der Invasion und der Eroberung. Sie ist eine durch Gewalt erlangte Herrschaft: Ein Souverän taucht auf, er erobert ein Gebiet, er erringt den Sieg. Das Subjekt wird zum politischen Subjekt, wenn es – angesichts der Aufforderung des Kriegsgewinners, sich zu unterwerfen oder zu sterben – nachgibt und die neu eingerichtete Macht akzeptiert. Das ist das Gemeinwesen durch Aneignung. „Ein Gemeinwesen durch Aneignung besteht dort, wo die souveräne Macht durch Gewalt erworben wird. Und sie wird durch Gewalt erworben, wenn Menschen, einzeln oder viele zusammen durch Stimmenmehrheit aus Furcht vor Tod oder Knechtschaft dem Mann oder der Versammlung, die ihr Leben und ihre Freiheit in der Gewalt haben, Ermächtigung für ihre Handlungen geben.“ 5
Diese Unterscheidung ist von Historikern und Philosophen lang und breit diskutiert worden. Was dabei aber als das wesentliche Element angesehen wurde, ist die Tatsache, dass Hobbes die Unterscheidung zwischen diesen zwei Formen der Souveränität einführt, um ihren Unterschied aufzuheben. Man könnte glauben, dass die Form „Gesellschaftsvertrag“ und die Form „Aneignung“ einander widersprechen, dass sie zwei gegensätzliche Modalitäten des Verhältnisses ausdrücken, in dem das Subjekt in der Unterwerfung unter den Souverän steht, und dass folglich diese zwei Typen des Gemeinwesens durch unterschiedliche Arten von Legitimität gekennzeichnet sind. Hobbes’ Konstruktion hat nun aber die Funktion aufzuzeigen, dass der Akt der Subjektivierung, durch den ein Individuum zum politischen Subjekt wird, in beiden Fällen auf ein und derselben Leidenschaft beruht, nämlich auf der Angst.
Die Errichtung eines Gemeinwesens durch Einsetzung gründet nach Hobbes auf der Furcht, die jeder vor dem anderen empfindet, und auf dem Wunsch, diese Situation der Unsicherheit zu beenden, während das Gemeinwesen durch Aneignung auf der Angst vor dem aneignenden Souverän gründet: zwei Ängste also, die aus unterschiedlichen Quellen stammen, Ängste nichtsdestoweniger, und weil es daher letztlich ein und dieselbe Logik ist, die in beiden Formen der Konstitution der Souveränität am Werk ist, kommt auch beiden Formen dieselbe Legitimität zu.
Die kontra-intuitive Behauptung, dass der Souverän durch Einsetzung die gleiche rechtliche Legitimität besitze wie der Souverän durch Aneignung, ist das, was die politische Theorie, einschließlich Foucault 6, aus Hobbes’ Werk lernt. Diesen Nachweis hält man für sein Bravourstück.
Und doch liegt etwas viel Sonderbareres in dieser Überlegung, die nicht hinreichend kommentiert wurde, wahrscheinlich, weil diesen Punkt aufzugreifen bedeutet, für einen naiven Autor gehalten zu werden. Die Gefahr, sich der Anschuldigung der Naivität auszusetzen, hat übrigens große Implikationen. Sie zeigt das Vorhandensein einer Art von autoimmunisierenden Vorrichtung in der politischen Philosophie, die mit besonderer Intensität hinsichtlich der Theorien des Gesellschaftsvertrags, des Konstruktivismus und der deliberativen Demokratie zum Einsatz kommt: Wenn man die konstitutiven Hypothesen des Feldes nicht akzeptiert, riskiert man, der Naivität bezichtigt zu werden und somit die Pertinenz seiner Aussagen entkräftet zu sehen, was bewirkt, dass die grundlegenden Hypothesen des Feldes von einem legitimen Diskurs letztlich niemals in Frage gestellt werden können, weil die Legitimität die Anerkennung der konstitutiven Hypothesen voraussetzt … Dieses System der Einschüchterung und Selbstbestätigung ist im Grunde demjenigen sehr ähnlich, das im Feld der Gegenwartskunst am Werk ist. Und es erklärt die automatische Fortführung einer Denkweise, deren Existenz niemand in Frage zu stellen wagt.
Worüber man beim Lesen von Hobbes’ Text erstaunt sein sollte, ist die Tatsache, dass die Wirklichkeit unserer Beziehung zur Politik an den zwei Modalitäten des Souveränität, von denen er spricht, völlig vorbeigeht.
Hobbes unterscheidet zwei Weisen des Eintretens in den Staat und der Hervorbringung des Subjekts als Untertan des Souveräns. Diese zwei Möglichkeiten haben jedoch keinen Bezug zur Wahrheit unserer Erfahrungen. Sie sind keine Modelle, sondern Fiktionen. Letztlich könnte man behaupten, dass nur das Gemeinwesen aus Aneignung eine Form darstellt, die manchmal – und eigentlich sehr selten – geschichtliche Wirklichkeit aufweist, nämlich für die Kämpfer in einem Krieg im Moment der Niederlage, für die Mitglieder eines kolonisierten Gebiets im Moment der Eroberung … Aber darüber hinaus? Ob es nun im Rahmen „kolonialer“ Systeme, „monarchistischer“ oder „demokratischer“ Regime ist – ich setze diese Ausdrücke hier in Anführungszeichen, denn wir werden über diese Unterscheidungen und Bezeichnungen nachdenken müssen –, wer kann seine Beziehung zum Staat in einer der zwei Formen beschreiben, von denen Hobbes spricht? Die Einrichtung des Staats und der Eintritt des Subjekts in den Staat nehmen praktisch niemals die Form eines freiwilligen und ausdrücklichen Vertrags an.
Der Souverän, so wie Hobbes ihn in der Theorie vom Aneignungsstaat beschreibt, würde sagen: Du unterwirfst dich, du wirst mein Untertan, mein politisches Subjekt, oder ich lasse dich hinrichten. Deshalb behauptet Hobbes, dass der Aneignungsstaat ebenso legitim wie der Einrichtungsstaat ist, denn beide beruhen auf der Zustimmung der Subjekte und auf einem Akt der Anerkennung.
Wenn man die reale Erfahrung des politischen Subjekt-Werdens beschreibt, dann gibt es die Wahl, von der Hobbes spricht, nicht. Wir haben niemals die Wahl. Es stimmt nicht, dass es eine Alternative zur politischen Zugehörigkeit gibt. Die Tatsache, unter der Herrschaft einer Macht zu stehen, die sich das Recht nimmt, über uns zu verfügen, wird uns mit der Geburt auferlegt. Es gibt keinen Vertrag, es gibt keine Unterwerfung, weil es niemals die Möglichkeit gibt, sich nicht zu unterwerfen und nicht Teil der Rechtsordnung zu sein. Wenn wir geboren werden, gibt es bereits eine Rechtsordnung, sie ergreift Besitz von uns und wir müssen sie dulden. Das Subjekt steht in keinem Konstitutionszusammenhang mit der Ordnung, in der es sich befindet. Eher könnte man von einer Gefangennahme sprechen.
Hobbes stellt die Wahl an den Ursprung des politischen Subjekts, obwohl in Wirklichkeit die Frage des Staats die Frage einer erzwungenen Zugehörigkeit ist: Ohne dass man mich um meine Meinung gefragt hat, ohne dass ich meinen Willen formell oder vertraglich ausgedrückt habe, bin ich de facto Teil des Staats als Untertan oder Bürger. Thomas Bernard sagte, in einer Formulierung, die Pierre Bourdieu gerne zitiert: „Der Staat hat mich, wie alle andern auch, in sich hineingezwungen“ 7. Wir werden im Staat geboren, vom Staat erfasst, von ihm definiert. Wir sind Objekte des Staats, dem Staat unterworfen. Wir sind in ihm eingeschlossen – ich werde darauf zurückkommen.
Anstatt zu sagen: Wenn wir geboren werden, sind der Staat, das Recht und auch die Polizei schon da, und unsere Geburt als politisches Subjekt ist das Ergebnis eines Zwangs und nicht das Ergebnis einer Unterschrift, schreibt Hobbes: Das politische Subjekt ist dem Recht unterworfen, weil es einen Vertrag unterschrieben hat, und es hat diesen Vertrag entweder aus Angst vor den anderen oder aus Angst vor dem Souverän unterschrieben.
Realismus und Gesellschaftsvertrag
Man könnte darauf natürlich antworten, dass Hobbes’ Projekt der Tradition des Gesellschaftsvertrags angehört und dieser Bereich des Denkens schließlich mit einer hypothetischen Vorstellung vom Menschen und der Gesellschaft arbeitet, um eine Theorie der Souveränität und der Rechtmäßigkeit zu konstruieren. Doch dieser Einwand ist nicht gültig. Hobbes’ Vorgehen lässt sich nicht in die Tradition des Gesellschaftsvertrags einordnen, so wie sie sich von Jean-Jacques Rousseau bis John Rawls entwickelt.
Читать дальше