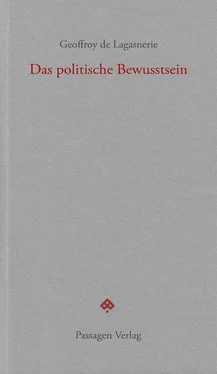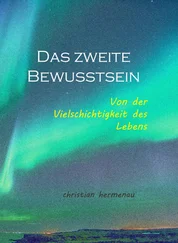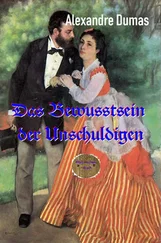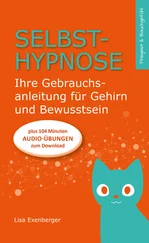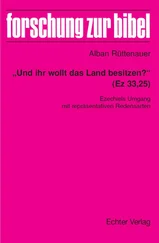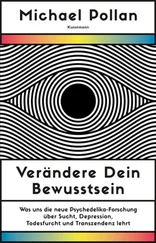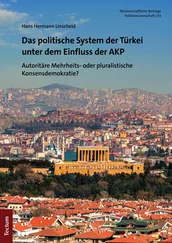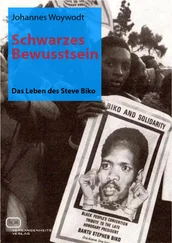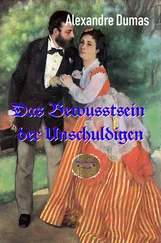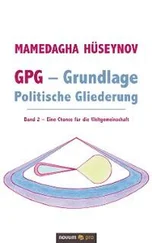Wenn wir auf die Welt kommen, ist der Raum der Sprache bereits da. Die Intuition, die ich ausarbeiten möchte, lautet, dass die Sprache, die unser Verhältnis zur Politik vorformt und mit der wir uns als Subjekte konstruieren, von der Wirklichkeit losgelöst ist. Von dem Augenblick an, da man zu sprechen beginnt, scheint die Politik ein Bereich zu sein, in dem Verzerrungs- und Mystifizierungsoperationen ablaufen. Überall – bei den unterschiedlichsten Autoren, auf der Straße und in Büchern – treten leere Wörter und Abstraktionen an die Stelle der Wirklichkeit, gibt man vor, durch mythologische Erzählungen getreu Rechenschaft davon, was wir sind, ablegen zu können, werden sinnlose Formeln wie Offensichtlichkeiten verwendet, werden rechtliche oder politische Fiktionen, deren Fiktionalität eingestanden wird, als notwendige Grundlagen für die Reflexion gesetzt. Wie kann man zum Beispiel von „Volkswille“ oder „Volkssouveränität“ oder „Volk“ in Gesellschaften sprechen, die geprägt sind von einer Vielfalt an Meinungen und oppositionellen Stimmen, von sozialen Konflikten, von der Weigerung, sich zu beteiligen, von Auseinandersetzungen zwischen Mehrheit und Minderheit, zwischen denen, die sprechen, und denen, die schweigen oder zum Schweigen gebracht werden? Wie kann man den Ausdruck „Bürger“ dort verwenden, wo es eine Vielfalt von Identitäten, Abhängigkeiten und Spaltungen gibt? Es ist auch nicht selten, dass Regierungen, die von einer Minderheit der Wähler gewählt wurden, vorgeben, dass die Demokratie auf dem Prinzip der Übertragung der „Volkssouveränität“ mittels Wahlen „gegründet“ ist, worauf ihre Gegner, anstatt diese Kategorien zu verwerfen, erwidern, sie verkörperten den eigentlichen „Volkswillen“ … Hat man vergessen, dass es vor ein paar Jahren in Paris, als im Zuge der Nuit debout genannten Bewegung Aktivisten und Intellektuelle behaupteten, sie seien „das Volk“ und würden „eine Verfassung formulieren“, obwohl da nur ein paar Hundert Personen versammelt waren, genügte, sich umzuschauen, um festzustellen, dass die Taxifahrer, Café-Kellner, Händler und Apotheker ihr Leben weiterführten wie eh und je, dass man nur 100 Meter weiter in die umliegenden Straßen gehen musste, um zu sehen, dass sich nichts änderte? Sogar die politische Philosophie und die Rechtstheorie entkommen diesem sonderbaren Dispositiv nicht. Es gibt hier keinen Bruch zwischen den alltäglichen Formen des Verhältnisses zur Politik und den Ausführungen der Gelehrten. Wenn Jürgen Habermas vom öffentlichen Raum der Debatte und von intersubjektiver Konstruktion des Rechts spricht, wenn Hannah Arendt von der Politik als einem „gemeinsamen Handeln“, John Rawls von der Demokratie als einem Regime spricht, in dem die Macht „freier und gleicher Bürger herrscht, die in einem Gemeinschaftskörper konstituiert sind“, wenn Juristen die Begriffe „konstituierend“, „Gesetzgeber“, „öffentliche Ordnung“ verwenden usw., wie sollte man – selbst wenn man kruden empiristischen Argumenten misstrauen muss – sich nicht fragen: Wovon reden sie bloß? Worauf verweist das, was sie sagen? Warum verwenden sie derlei fiktive Ausdrücke? Haben sie schon einmal eine Parlamentsdebatte im Fernsehen gesehen? Haben sie schon einmal einen Politiker in Aktion gesehen, einen Richter mit einem Angeklagten sprechen gehört oder einen Präfekten eine Entscheidung über Einwanderer treffen gesehen? Sind sie schon einmal in ein Gefängnis gegangen? Haben sie schon einmal gesehen, wie Wahlkämpfe ablaufen? Wie kommen sie dazu, die Politik ausgehend von einem Weltbild zu denken, das durch jeden – auch noch so flüchtigen – soziologischen Blick auf die Wirklichkeit widerlegt wird?
Wenngleich der Raum der Politik oft als der Bereich der Ausübung der Rationalität dargestellt wird, im Gegensatz zur Privatsphäre, in der der Affekt und das Interesse herrschten, ist es gut möglich, dass er einer der Hauptorte der Verblendung und des Automatismus ist. Wenn wir eine Eigenschaft unseres politischen Diskurses hervorheben sollten, dann wäre das die Tatsache, dass seine Sprecher – gleichsam systematisch – dadurch Positionen beziehen, dass sie Verzerrungs- und Mystifizierungsprozesse bedienen. Es ist, als ob der Wortschatz und die Sprache dieses Bereichs eine Funktion ausübten, die im Gegensatz zu ihrer eigentlichen Aufgabe steht, und nicht dazu dienten, etwas zu benennen, sondern zu verbergen. Sich selbst zu belügen, sich selbst gerade in dem Moment zu verfehlen, in dem man behauptet, über sich zu sprechen, wäre das Kennzeichen unserer Position als politisches Subjekt. Es ließe sich nicht einmal behaupten, dass in unserem politischen Diskurs eine Verzerrungslogik am Werk ist, vielmehr müsste man sagen, dass unser politischer Diskurs gänzlich auf der Grundlage von Verzerrungen erzeugt wird. Politisch zu denken, scheint zu implizieren: in Fiktionen zu denken .
2. Hobbes, die Wissenschaft, der Mythos
Die Logik der Mystifizierung, die den Kern unserer politischen Moderne ausmacht, lässt sich aufzeigen, indem wir uns Thomas Hobbes’ Leviathan zuwenden. Es ist offensichtlich kein Zufall, dass es mir zweckmäßig erscheint, dieses Werk zum Ausgangspunkt zu nehmen. Der Leviathan ist – geschichtlich betrachtet – eines der Gründungswerke der politischen Theorie und folglich hat die Geste, die es vollzieht, einen Modus der Problematisierung initiiert, den viele Autoren danach bewusst oder unbewusst übernommen haben. Hobbes hat Gewohnheiten und Reflexe geschaffen, die unseren Diskurs, so wie er uns umgibt und als sprechende und fühlende Subjekte hervorbringt, bis heute prägen.
Es gibt noch einen anderen Grund dafür, dass Hobbes’ Analyse ein nützliches Werkzeug bildet, mit dem wir die Natur unserer politischen Denkweisen aufzeigen können: Hobbes bezeichnet sein Projekt nämlich als rationalistisch und wissenschaftlich. Er beansprucht, mit allen Leidenschaften, mit oberflächlichen und parteiischen Beobachtungen zu brechen und zum ersten Mal eine „echte Wissenschaft“ von der Politik zu konstruieren, die sich – wie die Mathematik – von den Regeln der Vernunft und der Beobachtung leiten lässt. 1Hobbes’ Projekt besteht nicht darin, politische „Philosophie“ zu betreiben, sondern darin, eine autonome, illusions- und vorurteilsfreie Wissenschaft zu begründen. 2Sein Unterfangen eröffnet demnach ein Terrain, auf dem es möglich wird, sich der Tatsache bewusst zu werden, dass man in unserem politischen Diskurs gerade in dem Moment, da man das Wahre zu sagen behauptet, ohne Unterlass das Falsche sagt.
Hobbes will seine Wissenschaft von der Politik begründen, indem er die Souveränität aus den Eigenschaften des Menschen und aus den Beziehungen zwischen den Menschen deduziert. Er arbeitet daher im ersten Teil seines Werks eine Theorie der Affekte, der Leidenschaften, der Vernunft und der Erfindung aus. Er möchte auf diese Weise eine materialistische und objektive Beschreibung der menschlichen Natur liefern, um daraus in einem zweiten Schritt ein Wissen über die Politik abzuleiten.
Doch sobald Hobbes „das Gemeinwesen“ zum Gegenstand nimmt, sobald er anfängt, über die Geburt des politischen Subjekts nachzudenken, gibt er plötzlich die Vernunftlogik, die Logik der Feststellung und der Argumentation auf.
Hobbes führt zwei mögliche Arten der Verfassung des Gemeinwesens an, oder genauer zwei mögliche Weisen für das Subjekt, in ein Verhältnis zu einem Souverän zu treten. Es gebe zwei Formen des Eintretens in die politische Abhängigkeit ( sujétion ) 3und folglich zwei Arten von Gemeinwesen. Es gebe einerseits das Gemeinwesen durch Einsetzung oder Institution: Ein Gemeinwesen ist durch Einsetzung gegründet, wenn Individuen sich versammeln und eine Abmachung oder eine Vereinbarung treffen, um eine Person einzusetzen, die das Recht hat, sie zu vertreten. „Ein Gemeinwesen gilt als durch Einsetzung gegründet, wenn eine Menge von Menschen sich einigt und einen Vertrag schließt, jeder mit jedem, daß jeder beliebige Mensch oder jede Versammlung von Menschen, dem die Mehrheit das Recht gibt, ihrer aller Person zu vertreten (das heißt ihr Repräsentant zu sein), von jedem einzelnen, ob er dafür oder dagegen stimmt, für seine Handlungen und Entscheidungen in gleicher Weise Ermächtigung erhält.“ 4
Читать дальше