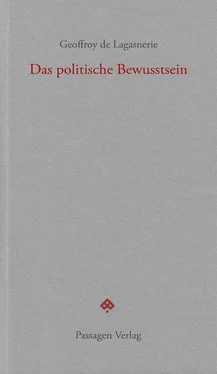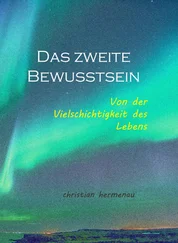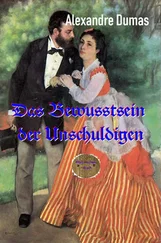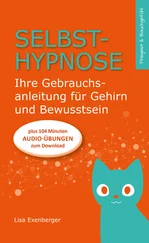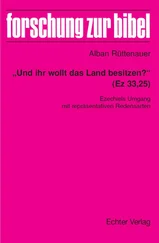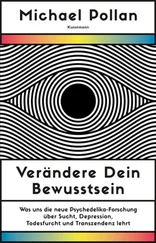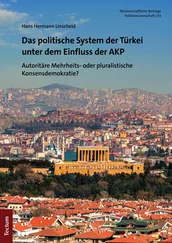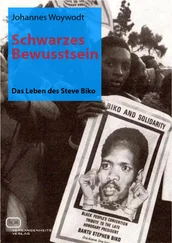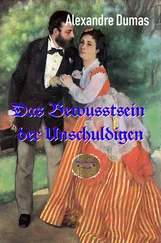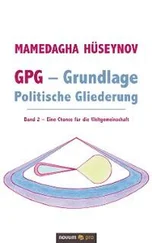Diese Analyse der Kultur als Vermittlerin macht deutlich, dass der Theoretiker die Art und Weise, wie Individuen das, was sie erleben, erfahren, nicht als gegeben hinnehmen darf. Es gibt keine spontane oder eigene Erfahrung. Das, was die Individuen als „ihre“ Erfahrung verspüren, ist oft nichts anderes als die Art und Weise, wie die Macht uns eine bestimmte Anzahl von Reaktionsweisen auf das, was uns geschieht, einbläut.
Es herrscht – vor allem an amerikanischen Universitäten – die verquere Auffassung vor, dass es unangemessen ist, den Aussagen von Akteuren zu widersprechen, weil eine solche Haltung ihnen Gewalt antäte. Doch in Wirklichkeit unterschlägt diese Vorannahme, dass es keine reine Erfahrung gibt und dass soziale und epistemologische Gewalt befreiend sein kann, wenn sie es ermöglicht, sich von lügnerischen und eingefahrenen Diskursen zu befreien, die, ob man es will oder nicht, oft den Rahmen für das eigene Denken vorgeben.
Die Rolle der Objektivierung besteht darin, das zu bezeichnen, was hinter den kulturellen Ideologien und ihrer ungeachtet die Wirklichkeit gelebter Leben ausmacht. Die Zuweisungslogik ist in allen Gesellschaften am Werk und in allen Gesellschaften gründet sie auf einem Zwangsakt und einem Kräfteverhältnis. Die Ordnung weist den Individuen Plätze und Positionen gewaltsam und willkürlich zu. Doch diese Wirklichkeit wird in kapitalistischen Gesellschaften durch ideologische Mystifizierungen verschleiert, durch die „ästhetischen Formen“, denen Agenten sich einordnen und die bewirken, dass Letztere das, was in den Bereich eines Zuweisungsmechanismus fällt, als das Ergebnis einer freien Entscheidung oder einer persönlichen Vorliebe erleben. Wie Didier Eribon sagt,
droht jede Soziologie oder Philosophie, die den Standpunkt der Akteure oder den Sinn, den sie ihren Aktionen beimessen, in den Mittelpunkt stellt, zur bloßen Mitschrift jener unreflektierten Beziehungen zu werden, die die sozialen Agenten zu ihren eigenen Praktiken und Wünschen unterhalten, zu einer simplen Fortschreibung der Welt, wie sie ist, zu einer Rechtfertigungsideologie der bestehenden Verhältnisse 25.
Die kulturellen Formen verändern nicht die Wirklichkeit. Sie trüben unsere Wahrnehmung und unterstützen die Selbstmystifizierungsformen. Die Brutalität der Welt entfaltet sich unabhängig von der Sprache, sodass die Wahrheit über die Welt und das Subjekt zu sagen darin besteht, sie unterhalb der Sprache zu suchen, während spontaner Glaube an die Sprache, der zu sehr respektiert, was die Leute „über ihre Erfahrung sagen“, uns dazu verurteilen würde, an der Reproduktion mystifizierender Wahrnehmungsformen teilzunehmen und die Theorie zu einer Helferin der Ordnungskräfte zu machen.
II. Die Reduktion der Politik auf das, was sie ist
1. Die Autonomie der Politik
Man hätte vielleicht erwartet, dass eine Untersuchung der Politik nacheinander eine Reihe von klassischen und deutlich abgegrenzten Fragen thematisiert: die Rechtssysteme, das Gesetz, den Widerstand und die Staatbürgerschaft. Doch eine allgemeine Kritik des Bewusstseins in Angriff zu nehmen, erfordert in Wirklichkeit eine zusätzliche Operation. Man muss zu den Konstruktionsprinzipien unseres Verhältnisses zur Politik selbst zurückgehen.
Das Dasein einer in unserer Sprache so wirkmächtigen mythologischen Logik ist vielleicht die Folge der Konstitution dieses Erfahrungsbereichs. Unsere Beziehung zur Politik steht nämlich mit einem Diskursuniversum in Verbindung, dessen Herausbildung und Äußerungsvollzug auf einer sonderbaren Voraussetzung beruhen: die Voraussetzung, dass die im Bereich der Politik agierenden Entitäten nicht dieselben seien wie diejenigen, die in anderen Bereichen des Lebens am Werk sind.
In unserem Sprachgebrauch gibt es einen Kipppunkt, der auftaucht, wenn wir beginnen, von Politik zu sprechen: Wir verwenden dann plötzlich Wörter, Argumentationen und Begriffe, die nur für diese Interaktions- und Erfahrungssphäre gültig sind. Wir greifen auf einen Wortschatz zurück, der in keiner anderen Sphäre unseres Lebens Anwendung findet: Staatsbürgerschaft, das Volk und seine Interessen, Volkssouveränität, Staatswesen, Legitimität, Gemeinwille, kollektive Deliberation, Gemeinwohl … Anders gesagt, wir halten es für gesichert, dass „die Politik“ existiert, dass ein Teil unseres Daseins sich auf einer bestimmten Ebene abspielt, die „die Politik“ heißt.
Jacques Derrida behauptet in Das Tier, das ich also bin , dass über die Gegensätze hinweg und trotz des Anscheins ihrer Gegnerschaft Descartes, Heidegger und Levinas in Wirklichkeit darin übereinstimmen, dass ihre Theorie des Eigentlichen des Menschen auf der Ausschließung des Tiers beruht und dass Menschsein immer bedeute, kein Tier zu sein. 26Man könnte genauso gut sagen, dass die politischen Philosophen jenseits ihrer Meinungsverschiedenheiten oder vielmehr obwohl sie so tun, als würden sie einander widersprechen, einen sie vereinenden Punkt miteinander teilen: Sie konstruieren ihren Diskurs auf der Abstraktion der Politik vom Rest der Welt – auf der Ausschließung dessen, was sie „Soziologismus“, „Ökonomismus“, „Moral“ nennen. Die politische Philosophie definiert sich als Disziplin durch ihren Anspruch, die Besonderheit der Politik als Besonderheit eines Wirklichkeits-, Handlungs- und Erfahrungsbereichs zu bestimmen. Sie versucht nicht, die politischen Institutionen als Teil des Spiels sozialer Kräfte und ihrer Konflikte zu begreifen, sondern im Gegenteil, sie autonom zu machen. Das für unseren politischen Diskurs konstitutive Vorurteil kann mit dem Ausdruck Autonomismus bezeichnet werden.
Einer der Texte, die mit größter Deutlichkeit veranschaulichen, inwiefern der Gründungsmoment einer Theorie, die sich als politische Theorie darstellt, in einer Konstruktion der Politik als einer autonomen Sphäre besteht, findet sich bei Carl Schmitt.
Die Definition der Politik erfordert es, Schmitt zufolge, die ihr eigentümliche Unterscheidung freizulegen, die sich nicht mit moralischen, ästhetischen, ökonomischen oder religiösen Kategorien überlappen darf. Die Politik wäre ein Bereich mit eigenständigen Kriterien. Und der Widerpart zu jedem echten Politikverständnis fände sich in den Versuchen, die Politik auf etwas anderes als sie selbst zu reduzieren und ihr eine, wie Schmitt sagt, heteronome Sprache aufzuerlegen.
Eine Begriffsbestimmung des Politischen kann nur durch Aufdeckung und Feststellung der spezifisch politischen Kategorien gewonnen werden. Das Politische hat nämlich seine eigenen Kriterien, die gegenüber den verschiedenen, relativ selbständigen Sachgebieten menschlichen Denkens und Handelns, insbesondere dem Moralischen, Ästhetischen, Ökonomischen in eigenartiger Weise wirksam werden. Das Politische muß deshalb in eigenen letzten Unterscheidungen liegen, auf die alles im spezifischen Sinne politische Handeln zurückgeführt werden kann. Nehmen wir an, daß auf dem Gebiet des Moralischen die letzten Unterscheidungen Gut und Böse sind; im Ästhetischen Schön und Häßlich; im Ökonomischen Nützlich und Schädlich oder beispielsweise Rentabel und Nicht-Rentabel. Die Frage ist dann, ob es auch eine besondere, jenen anderen Unterscheidungen zwar nicht gleichartige und analoge, aber von ihnen doch unabhängige, selbständige und als solche ohne weiteres einleuchtende Unterscheidung als einfaches Kriterium des Politischen gibt und worin sie besteht. Die spezifisch politische Unterscheidung, auf welche sich die politischen Handlungen und Motive zurückführen lassen, ist die Unterscheidung von Freund und Feind. Sie gibt eine Begriffsbestimmung im Sinne eines Kriteriums, nicht als erschöpfende Definition oder Inhaltsangabe. 27
Читать дальше