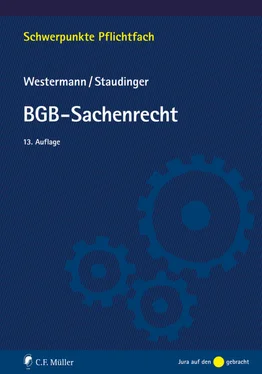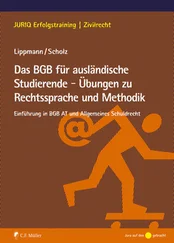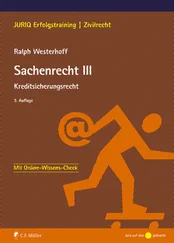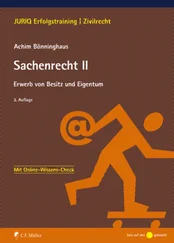Harm Peter Westermann - BGB-Sachenrecht
Здесь есть возможность читать онлайн «Harm Peter Westermann - BGB-Sachenrecht» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:BGB-Sachenrecht
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
BGB-Sachenrecht: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «BGB-Sachenrecht»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Das Lehrbuch behandelt die examensrelevanten Fragen des Sachenrechts in gründlich überarbeiteter und teils neu konzipierter Weise. Es trägt inhaltlich den ständig weiter differenzierten Positionen im Kreditsicherungsrecht, den Einflüssen des Umweltrechts und neuer technischer Gegebenheiten auf das Nachbarrecht sowie der zunehmenden Bedeutung des Mobiliarsachenrechts gegenüber dem Grundstücksrecht Rechnung. Das Ineinandergreifen von schuld- und sachenrechtlichen Fragestellungen wird anhand von Fällen mit Lösungen veranschaulicht.
BGB-Sachenrecht — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «BGB-Sachenrecht», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
§ 1 Einführung› IV. Ausblick
IV. Ausblick
25
Insgesamt hat das Sachenrecht durch die Problematisierung des Gedankens des Schutzes absoluter Rechte, zugleich aber durch die Einsicht in die Notwendigkeit flexibler Verkehrsformen und des Einsatzes von Sacheigentum für Zwecke der Kreditsicherung eine erhebliche Aktualität behalten. Allerdings bedeutet dies auch, dass die früher zuweilen verbreitete Vorstellung einer starken Eigenständigkeit des sachenrechtlichen Denkens gegenüber dem Schuldrecht und den von ihm ausgehenden dogmatischen und politischen Impulsen nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Vielmehr ist das Sachenrecht integrierender Bestandteil des bürgerlichen Vermögensrechts.
Anmerkungen
[1]
Zur Zuordnungslehre Westermann/ H.P. Westermann , Sachenrecht, § 1 Rn 4; Wilhelm , Sachenrecht, Rn 2, 64; Wieling , Sachenrecht I, § 1 II 2 b.
[2]
Dabei können von der Verteidigung von Eigentum, also einem dinglichen Recht, durchaus auch personenbezogene Interessen umfasst sein, so in dem bekannten Fall der Fernsehjournalistin, die gegen die Veröffentlichung von Luftbildern ihres Anwesens auf Mallorca und die Beschreibung des Weges dorthin vorging (BGH NJW 2004, 762).
[3]
So ist § 1004 als eine der wichtigsten Anspruchsgrundlagen für den zivilrechtlichen Schutz des sog. Allgemeinen Persönlichkeitsrechts anerkannt, BVerfG NJW 2006, 207; Erman /Klass , Anh. § 12 Rn 279; Schreiber , JURA 2013, 111 f; HK-BGB/ Schulte-Nölke § 1004 Rn 1.
[4]
Zu den verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten Erman /Bayer § 1030 Rn 7; HK-BGB/ Schulte-Nölke § 1030 Rn 1; Trömer , RNotZ 2016, 421 ff.
[5]
BGHZ 120, 239 (Die Frösche von Ingolstadt, dazu Rn 87).
[6]
Zur Einbeziehung von Dritt- und Allgemeininteressen in die Bewertung und Handhabung privater Rechtspositionen H.P. Westermann , AcP 208 (2008), S. 141 ff.
[7]
S. dazu Vieweg/Werner , § 1 Rn 10.
[8]
Zuletzt wieder von Koziol , AcP 212 (2012), S. 1, 16 f; früher von Kegel , FS für Mann (1973), S. 57 ff; Kupisch , JZ 1985, 101.
[9]
Man spricht auch von Neutralität, BGH NJW 1990, 384; Zimmermann , JZ 1985, 48; Wieling , Sachenrecht I, § 1 III 4 c; krit. Kegel aaO., S. 77; zum Ganzen auch Westermann/ H.P. Westermann , § 3 Rn 10.
[10]
Hierzu und zu weiteren Durchbrechungen des Abstraktionsprinzips s. Lieder/Berneith , JuS 2016, 673 ff.
[11]
Zur Verfügungsbefugnis s. Vieweg/Werner , § 4 Rn 56 ff.
[12]
Gegen die Vorstellung, die Formen des Sachenrechts seien im Wesentlichen „statisch“, daher H.P. Westermann , FS für Schapp, 2010, S. 507 ff.
[13]
Dem Käufer, der einen Sachmangel übersehen hat, steht ein Anfechtungsrecht nicht zu, das, obwohl tatbestandsmäßig an sich gegeben, von den Regeln der §§ 434 ff über die Gewährleistung verdrängt wird, zum Ganzen MünchKomm/ Westermann § 437 Rn 53–55; HK-BGB/ Saenger § 437 Rn 27.
[14]
Erörterung bei Kindl , JA 1996, 23, 28 f; Baur/Stürner , Übersicht 6a vor § 11 Rn 39.
[15]
Rechtspflegergesetz vom 5.11.1969 (BGBl I S. 2065); zur Eigentumsumschreibung dort § 20.
[16]
Zu den „sachenrechtlichen Nebengebieten“ in diesem Sinne zählen Agrarrecht, Forstrecht, Jagd- und Fischereirecht, Wasserrecht und Bergrecht, wobei in unterschiedlichem Ausmaß staatliche und zT durch besondere Behörden wahrzunehmende Interessen in den Vordergrund gerückt sind, s. im Einzelnen Westermann/ H.P. Westermann , § 6.
[17]
Gesetz zur Begrenzung der mit Finanzinvestitionen verbundenen Risiken v. 18.8.2008, BGBl I S. 1666.
[18]
Näher wiederum H.P. Westermann , FS für Schapp, 2010, S. 507.
[19]
Dazu H.P. Westermann , Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, Journal of South African Law, 2011, 1 ff.
Teil I Eigentum und Besitz
Inhaltsverzeichnis
§ 2 Funktionen des Eigentums und des Besitzes
§ 3 Privatnützigkeit und Sozialpflichtigkeit des Eigentums, Eigentumsschutz und Nachbarrecht
§ 4 Ergänzende Zusammenfassung der Darstellung des Besitz- und Eigentumsrechts
Teil I Eigentum und Besitz› § 2 Funktionen des Eigentums und des Besitzes
§ 2 Funktionen des Eigentums und des Besitzes
Inhaltsverzeichnis
I. Erwerb von Eigentum
II. Schutz von Eigentum und Besitz
26
Fall 2:
Im Sommer 1989 hatten Dr. M und seine Familie (Frau und Tochter) während ihres Badeurlaubs auf Norderney von der Kurverwaltung für 3 Wochen einen nummerierten Strandkorb gemietet und ihn an einem bestimmten Platz am Badestrand aufstellen lassen. Allerdings sieht sich die Kurverwaltung bei steigender Flut manchmal gezwungen, die Strandkörbe von ihrem Standort zu entfernen und in die Dünen zu stellen. An einem der folgenden Nachmittage macht Dr. M mit seiner Familie bei stürmischem Wetter einen Spaziergang am Badestrand und möchte sich eine Zeit lang in dem von ihm gemieteten, etwa 100 m vom gewöhnlichen Platz an einer geschützten Stelle stehenden Strandkorb ausruhen. Zu seinem Ärger trifft er in dem Strandkorb den 20-jährigen Ralf und die 19-jährige Reni an, die sich weigern, den Korb zu räumen, der, wie sie sagen, Dr. M so wenig gehöre wie ihnen, jedenfalls solle die Familie M sie in Ruhe lassen. Dr. M möchte wissen, ob er sich dieses Verhalten gefallen lassen müsse. Lösung Rn 29, 41
Fall 3:
Im Fall 2verlassen Ralf und Reni nach einem heftigen Wortwechsel den Strandkorb und gehen zur Strandpromenade zurück, wo Ralf sein Fahrrad unverschlossen abgestellt hatte. Als sie ankommen, sehen sie gerade, wie der 22-jährige Holger sich auf das Fahrrad setzt und losfährt. Ralf rennt hinterher, holt Holger ein und stößt ihn mit Gewalt vom Fahrrad herunter. In der anschließenden Auseinandersetzung verteidigt sich Holger damit, Ralf habe das Fahrrad gekauft und noch nicht voll bezahlt, es gehöre noch dem Händler K, der ihm erlaubt habe, das Fahrrad zu benutzen, da er an der Zahlungswilligkeit des Ralf zweifle. Durfte Ralf sich das Fahrrad auf diese Weise wiederholen? Lösung Rn 33, 40, 43
Teil I Eigentum und Besitz› § 2 Funktionen des Eigentums und des Besitzes› I. Erwerb von Eigentum
I. Erwerb von Eigentum
27
In vielen praktischen Fällen, vor allem auch universitären Übungsfällen, ist als Ausgangsfrage, etwa für Herausgabeansprüche gem. § 985, von Bedeutung, ob eine Person Eigentum an einer Sache hat. Das kann bei entsprechender Formulierung in der Frage unterstellt werden, muss aber gewöhnlich anhand der möglichen Erwerbstatbestände untersucht werden. Das zeigen auch die beiden Ausgangsfälle: Sollte Dr. M als Eigentümer des Strandkorbs Ralf und Reni zur Räumung veranlassen wollen, müsste er den Strandkorb (wohl von der Kurverwaltung, also der Gemeinde) rechtsgeschäftlich erworben haben, wie auch Ralf, wenn er im Ausgangsfall 2 von Holger als Eigentümer das Fahrrad herausverlangen wollte. Dies muss also kurz geprüft werden; anders, wenn in Abwandlung des Falles 1 Frau M von Reni Herausgabe eines warmen Pullovers verlangt, den sie im Strandkorb vergessen hat, den sich aber jetzt Reni angezogen hat – hier kann Eigentum von Frau M unterstellt werden.
Der Erwerb von Sacheigentum kann kraft Gesetzes oder durch Rechtsgeschäft, nämlich Übereignung durch einen früheren Eigentümer, geschehen. Dafür muss ein wirksames Veräußerungsgeschäftfestgestellt werden, was sich nach den Regeln des Sachenrechts und des Allgemeinen Teils über Verfügungen richtet ( Rn 14). Gesetzliche Erwerbstatbeständesind der Erwerb von Todes wegen als Erbe, wobei zu bemerken ist, dass nach § 1922 das Vermögen des Erblassers, also der Nachlass, als Ganzes auf den oder die Erben übergeht, so dass es nur darauf ankommt, ob die betreffende Sache zum Nachlass gehört. Während hier der Erwerber, wenn er Erbe ist, das Eigentum ohne eigenes Zutun erwirbt, knüpfen andere gesetzliche Erwerbstatbestände an bestimmte menschliche Handlungen an, so bei der Herstellung einer Sache durch Verarbeitung oder Umbildung aus einer (auch einem anderen gehörigen) Sache (§ 950), ähnlich bei der Verbindung beweglicher Sachen mit einem Grundstück, also etwa dem Einbau in ein Haus (§ 946) oder bei der Vermischung beweglicher Sachen (§ 948)[1]. Eigentumserwerb kann auch durch Tathandlungen eines Aneignungsberechtigtengeschehen (§§ 953, 954, 956), was auch bei bis dahin herrenlosen beweglichen Sachen in Betracht kommt: Im Fall 2 ( Rn 26)findet die Tochter der Eheleute M eine offenbar aus ihrem Biotop vertriebene junge Landschildkröte, die sie mitnehmen und gesundpflegen möchte; Herr Dr. M entdeckt am Strand eine nach seiner Kenntnis außerordentlich seltene Muschel, die von der Flut angespült worden sein muss. Die meisten gesetzlichen Erwerbstatbestände können Folgeprobleme in Gestalt von Ausgleichsansprüchen der Personen nach sich ziehen, die durch den Erwerbsvorgang Rechte verloren haben, s. etwa § 951[2]. Im Gesellschaftsrecht gibt es weitere Formen der sog. Universalsukzession, so bei Verschmelzung von Gesellschaften, sog. Rechtsträger, zur Bildung eines neuen Rechtsträgers.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «BGB-Sachenrecht»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «BGB-Sachenrecht» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «BGB-Sachenrecht» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.