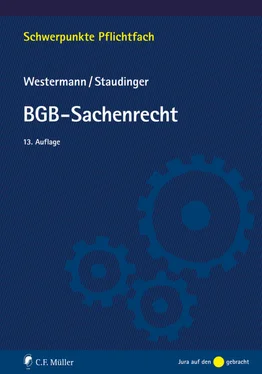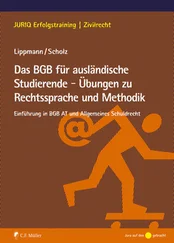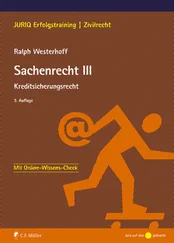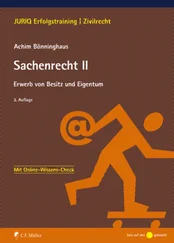19
Die handelnden Personen machen im Allgemeinen auch im Sachenrecht von Privatautonomie und Vertragsfreiheit Gebrauch, sie müssen aber in einigen Zusammenhängen auf die Mitwirkung der Gerichte zurückgreifen. Das gilt besonders im Grundstücksrecht, das für die Veräußerung, Belastung und Inhaltsänderung von Rechten grundsätzlich eine Eintragungim Grundbuch verlangt (§ 873). Sie ist Teil des zur Verfügung gehörigen Verlautbarungstatbestandes ( Rn 14), hat aber eine große Bedeutung durch den Umstand, dass sich an eine Grundbucheintragung im Zuge der Vermutung gem. § 891 die Möglichkeit eines Gutglaubenserwerbsvom nichtberechtigten Verfügenden knüpft (§ 892). Die Eintragungen im Grundbuch sind in einer besonderen Verfahrensordnung, der GBO, sehr genau geregelt, sie obliegen den Grundbuchämtern als Teilen des örtlich zuständigen Amtsgerichts, wobei innerhalb des Grundbuchamts die Zuständigkeit weitgehend nicht bei einem Richter liegt, sondern nach Maßgabe des Rechtspflegergesetzes[15] bei einem Rechtspfleger. Es kann also durchaus zutreffen, wenn im Ausgangsfallder Richter am Amtsgericht angibt, für die Eintragung des Professor S als Eigentümer nicht zuständig gewesen zu sein.
20
Die Notwendigkeit von Grundbucheintragungen bedingt dann auch, in Ergänzung des numerus clausus der dinglichen Rechte ( Rn 7), dass nur Eintragungen erfolgen können, die in der GBO vorgesehen sind. Schließlich gibt es Eintragungen, die im Zuge eines Rechtsstreits um Rechte an Grundstücken durch Verfügung des Gerichts erfolgen können, so der Widerspruch gegen die Richtigkeit einer bestehenden Grundbucheintragung, § 899 Abs. 2 (dazu Rn 427). Dass bei Maßnahmen der Zwangsvollstreckungsowohl in bewegliche Sachen als auch in Immobilien das Vollstreckungsgericht und ein Gerichtsvollzieher eingeschaltet werden müssen, ist keine Besonderheit des Sachenrechts, sondern folgt daraus, dass die zwangsweise Durchsetzung privater Ansprüche in unserem Ordnungssystem dem Staat zugewiesen ist.
§ 1 Einführung› II. Die systematische Stellung des Sachenrechts in der Kodifikation › 3. Sachenrechtliche Nebengebiete
3. Sachenrechtliche Nebengebiete
21
Die Nutzung von Grund und Boden, aber auch von Gewässern, das Betreten des Waldes als Naherholungsgebiet, Jagd und Fischerei, auch die Gewinnung von Bodenschätzen, haben zu gesetzlichen Regeln außerhalb des BGB mit teilweise öffentlich-rechtlichem Zuschnitt Anlass gegeben. Diese Normen schränken die Nutzung und Verfügbarkeit privater Rechte und damit auch des Grundeigentums zT erheblich ein, wofür seit einigen Jahren auch der Gedanke des Schutzes der Umweltvor den Folgen des Handelns und Verhaltens Privater maßgebend geworden ist[16]. Berührungspunkte gibt es ferner zwischen diesen Materien und dem im BGB geregelten Nachbarrecht (dazu Rn 62).
§ 1 Einführung› III. Gesellschafts- und rechtspolitische Aspekte des Sachenrechts
III. Gesellschafts- und rechtspolitische Aspekte des Sachenrechts
§ 1 Einführung› III. Gesellschafts- und rechtspolitische Aspekte des Sachenrechts › 1. Privateigentum als gesellschaftspolitisches Problem
1. Privateigentum als gesellschaftspolitisches Problem
22
Das im BGB (§ 903) noch als umfassendes Herrschaftsrecht verstandene, wenngleich auch schon bedeutenden Beschränkungen unterworfene Sacheigentum (§ 906, dazu Rn 80 ff), das als privatnütziges Recht auch Verfassungsrang hat (Art. 14 GG), ist trotzdem wegen der mit ihm verbundenen Monopolisierung eines Rechtsguts für den Inhaber Gegenstand allgemein-politischerDiskussionen gewesen, die sich zT auch auf die dem „bürgerlichen“ Recht (angeblich) zugrunde liegende Gewährleistung von subjektiven Rechten und Privatautonomie richten. Das bekannte Streben des Menschen nach privaten, vermögensrelevanten Rechtsgütern und ihrer Absicherung gegen den Staat wie gegen andere Private wird wegen der sich daraus zwangsläufig ergebenden Tendenz zur ungleichmäßigen Güterverteilung unter den Rechtssubjekten sowohl aus der Sicht des Staats („privater Reichtum und öffentliche Armut“) als auch aus der Perspektive ökonomisch weniger Erfolgreicher als bedenklich, die aktuell bestehende Verteilung als reformbedürftig empfunden. Unter diesen Umständen wird das Nachbarrecht des BGB zunehmend als ein Bestandteil einer im öffentlichen Interesse übergreifend zu gestaltenden Raumordnungverstanden. Auch gibt es sowohl im Kommunal- als auch im Landesrecht, durchaus auf der Grundlage bundesgesetzlicher Ermächtigungen, rechtliche Möglichkeiten zum Eingreifen in den privatrechtlichen Grundstücksverkehr, etwa in Gestalt von staatlichen Vorkaufsrechten, während die zeitweise zu beobachtenden Bestrebungen, Grundeigentum durch Steuern oder Abgaben verstärkt zu belasten, derzeit in den Hintergrund gerückt sind. Bei Immaterialgüterrechten wird unter Gesichtspunkten der Verbindung und der Abschwächung von Monopol- oder Oligopolstellungen verschiedentlich überlegt, ob Rechtsinhabern auferlegt werden kann (und muss), Wettbewerbern die Mitbenutzung besonderer, an sich privatautonom zu beherrschender Rechtsgüter zu gestatten, ihnen zB Durchleitungsrechte an Grundstücken einzuräumen.
§ 1 Einführung› III. Gesellschafts- und rechtspolitische Aspekte des Sachenrechts › 2. Ansätze zur Rechtsfortbildung
2. Ansätze zur Rechtsfortbildung
23
Das dritte Buch des BGB ist verhältnismäßig wenig Gegenstand gesetzgeberischer Reformen gewesen, obwohl solche etwa im Bereich der Benutzung von dinglichen Rechten zur Kreditsicherung( § 6) oft gefordert wurden. Dies hat sich erst in jüngster Zeit im Hinblick auf die Sicherung von Bankdarlehen durch Grundpfandrechte durch das auf Gefahren bei der Abtretung von Sicherungsgrundschulden reagierende sog. Risikobegrenzungsgesetz[17] zwar nicht grundlegend, aber doch in signifikanter Weise geändert, näher Rn 609. Schon seit Langem haben sich aber Rechtsprechung und wissenschaftliches Schrifttum veranlasst gesehen, beim Eigentumsvorbehaltskauf, dh bei der dabei als notwendig erkannten rechtlichen Anerkennung des wirtschaftlichen Werts der in der Begründung und Finanzierung der in § 449 vorgestellten Erwerbsaussicht des Vorbehaltskäufers, ein im Gesetz nicht vorgesehenes dingliches Recht, nämlich die sog. Anwartschaftzu entwickeln. Den Notwendigkeiten – wirtschaftlicher und rechtstechnischer Art – des gesetzlich nicht geregelten Kreditsicherungsrechts ( Rn 162) folgend, ist hierdurch ein besonderes, in das gesetzliche System der dinglichen Rechte nicht problemlos einzuordnendes Rechtsinstitut entstanden, und zwar ein veräußerliches, belastbares, auch als Gegenstand von Maßnahmen der Zwangsvollstreckung anerkanntes, aber dennoch nicht in allen Konturen zweifelsfreies Gebilde. Die Denkform der Anwartschaft ist auch auf das Grundstücksrecht übertragbar, und zwar auf die Position des Empfängers einer Auflassung seitens des verfügungsbefugten Grundstückseigentümers (§§ 873, 878 und dazu Rn 381), sie hat aber dort weniger Bedeutung erlangt. Dagegen bedeutet im Mobiliarsachenrecht die Anwartschaft eine bemerkenswerte Relativierung des numerus clausus der dinglichen Rechte und in den einzelnen Verfügungsformen auch ein Abrücken von manchen Folgen des Publizitäts- und sogar des Abstraktionsgrundsatzes[18], was auch im internationalen Vergleich Beachtung hervorgerufen hat[19].
§ 1 Einführung› III. Gesellschafts- und rechtspolitische Aspekte des Sachenrechts › 3. Die Bedeutung des Gutglaubensschutzes
3. Die Bedeutung des Gutglaubensschutzes
24
Unter den Interessen, die die gesetzliche Regelung des Sachenrechts kennzeichnen und die dort geregelten Konflikte weitgehend, wenn auch nicht allein, beherrschen, ist besonders das Bestreben hervorzuheben, bei Vorliegen bestimmter Rechtsscheinstatbestände den gutgläubigen Rechtsverkehr zu schützen. Dem dienen die Vorschriften über den Erwerb vom Nichtberechtigten im Recht der beweglichen (§ 932) wie der unbeweglichen Sachen (§ 892). Bezeichnend ist, dass bei Übertragung einer Forderung, die ohne Verlautbarungstatbestand vor sich geht ( Rn 14), ein Erwerb vom Nichtberechtigten nur im sehr begrenzten Rahmen des § 405 möglich ist. Im Übrigen geht der Gutglaubensschutz nicht uneingeschränkt zulasten des sein Recht verlierenden Eigentümers, der möglicherweise Ersatz- oder Ausgleichsansprüche gegen den nichtberechtigt Verfügenden aus Gesetz (§§ 816 Abs. 1, 989, 990) oder aus Vertrag hat und sich im Übrigen (außer gegen einen gutgläubigen Erwerber) gegen Übergriffe auf sein Eigentum mit einer Reihe von Ansprüchen (§§ 985, 1004, 1007) wehren kann.
Читать дальше