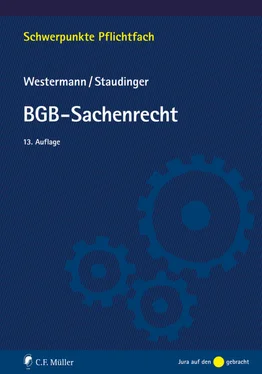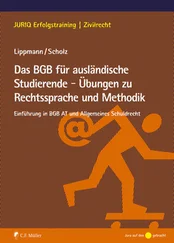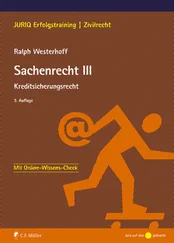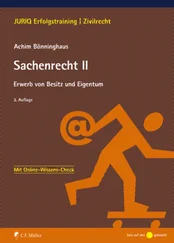1 ...8 9 10 12 13 14 ...33 41
Jedes dem Eigentümer gegenüber wirksame Recht zum Besitz schließt den Anspruch aus § 985 aus und gibt nicht etwa nur eine Einrede, § 986 Abs. 1. Rechte gegenüber dem Eigentümer, die diese Wirkung entfalten, sind etwa absolute Rechte wie ein Pfandrecht, aber auch relative Rechte, die dann allerdings dem Besitzer gerade gegenüber dem Eigentümer zustehen müssen.
Ist zB der Vermieter nicht Eigentümer, kann das Recht aus dem Mietvertrag dem Eigentümer, wenn er aus § 985 vorgehen will, nicht entgegengesetzt werden, anders, wenn der Vermieter seinerseits gegenüber dem Eigentümer besitzberechtigt ist. Wenn es im Fall 2die Kurverwaltung einem Unternehmer überlässt, im eigenen Namen die ihr gehörenden Strandkörbe zu vermieten, gibt es eine doppelte Besitzberechtigung Eigentümer-Vermieter (= mittelbarer Besitzer) und Vermieter/-Mieter (unmittelbarer Besitzer), die auch zugunsten des Letzteren wirkt. Diese Einzelheiten können sich bei Falllösungen auswirken, wenn es um die Nebenfolgen aus der Verletzung eines Herausgabeanspruchs, etwa den Schadensersatzanspruch aus § 990 geht, dazu Rn 297, 301.
42
Bei Bestehen eines Herausgabeanspruchs aus § 985 können sich für Besitzer und Eigentümer Rechte und Pflichten aus dem sog. Eigentümer-Besitzerverhältnisergeben. Das ist etwa für eine vom Besitzer zu vertretende Beschädigung der Sache von Bedeutung, wenn ein Anspruch aus Vertragsverletzung ausscheidet, weil der Vertrag unwirksam ist oder ein Vertrag gar nicht besteht. Dasselbe kann für den Ersatz etwaiger vom Besitzer gezogener Nutzungen gelten, s. dazu §§ 987, 989, 990, Rn 318 ff
43
Wenn im Fall 3K den Kaufvertrag (und die bedingte Übereignung im Zuge des Eigentumsvorbehalts) an Ralf wegen arglistiger Täuschung über die Zahlungsfähigkeit des Ralf nach § 123 angefochten hat, Ralf sich hierdurch aber nicht hat hindern lassen, das Rad weiter zu nutzen, kann er als unberechtigter Besitzer Nutzungsersatz schulden. Eine Beschädigung des Fahrrads, die er verschuldet hat, würde ihn nach § 823 zum Schadensersatz verpflichten, dessen Anwendung aber § 992 für den Fall eines Eigentümer-Besitzerverhältnisses ausschließt, so dass es insoweit bei dem Anspruch aus §§ 998, 990 bleibt, näher dazu Rn 308.
44
Insgesamt gehört das Verhältnis der Ansprüche aus §§ 987–999 und auch des Verwendungsersatzanspruchs des Besitzers aus § 994 zu anderen gesetzlichen und vertraglichen Ansprüchen zu den kompliziertesten Regelungskomplexen des Sachenrechts, die in der Grundtendenz einen vollständigen Schutz der mit dem Eigentum verbundenen vermögensmäßigen Interessen anstrebt. Zum Schutz des Eigentums gegen Störungen und Beeinträchtigungen der Nutzung s. Rn 68 ff
45
Nicht immer wird der Eigentümer einer Sache, die er nicht im unmittelbaren Besitz hat, bereit oder imstande sein, dem Besitzer, wenn ihm der Besitz genommen oder er darin gestört wird, durch Geltendmachung seiner Rechte aus Eigentum beizustehen. Dies und die erwähnte Friedensfunktion[21] des Besitzes haben dazu geführt, dass der Besitz zunächst unabhängig vom Besitzrecht als selbstständig schutzwürdige Rechtsposition anerkannt ist[22]. Das bedeutet, dass der Besitzer, dem die Sachherrschaft durch verbotene Eigenmacht iSd § 858 entzogen worden ist, von demjenigen Wiedereinräumungdes Besitzes verlangen kann, der ihm gegenüber „fehlerhaft besitzt“, § 861. Wenn der Inhaber der tatsächlichen Sachherrschaft in ihrer Ausübung gestört wird, hat er nach § 862gegen den für die Störung[23] Verantwortlichen einen Anspruch auf Beseitigungder vorhandenen und Unterlassungkünftiger Störungen. Man spricht hier von possessorischenAnsprüchen[24], die in einigen Aspekten große Ähnlichkeiten mit dem Schutz des Sacheigentums aufweisen. Auch ist anerkannt, dass der Besitz, allerdings nur der berechtigte, ein sonstiges Recht iSd § 823 Abs. 1 darstellt, so dass ein Deliktsschutz gegen einen schuldhaft handelnden Störer möglich ist, ähnlich, wenn und soweit die §§ 858 ff als Schutzgesetz iSd § 823 Abs. 2 anerkannt sind[25]. Ein praktisches Hindernis für die Durchsetzung dieser possessorischen Ansprüche liegt darin, dass der ehemalige oder in seiner Rechtsausübung gestörte Besitzer gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen müsste; deshalb geben die §§ 859, 860 – in einer Friedensordnung ausnahmsweise – das Recht, sich gegen verbotene Eigenmacht mit Gewalt zu wehren – Besitzwehrund Besitzkehr. Wie bei der Notwehr, mit der diese Maßnahme Ähnlichkeit hat, darf der Besitzer hierbei aber nur so weit gehen, als zur Abwehr nötig ist; die angewendete Gewalt muss auch im Verhältnis zu dem geschützten Rechtsgut stehen[26].
46
Als Holger im Fall 3das Rad wegzunehmen versuchte, das sich noch im Besitz des Ralf befand, beging er verbotene Eigenmacht iSd § 858, woran es nichts ändert, dass er möglicherweise annahm, von K zur Benutzung des Rades wirksam ermächtigt worden zu sein, denn K hat den Eigentumsvorbehalt und damit das Besitzrecht des Ralf noch nicht durch Rücktritt beendet (§ 449 Abs. 2). Ohnehin kommt es für die Rechtswirksamkeit nur auf das Fehlen der Zustimmung des unmittelbaren Besitzers an, diejenige eines mittelbaren Besitzers steht dem nicht gleich[27]. Wenn Holger schon Besitz ergriffen hat, ist Ralf berechtigt, den „auf frischer Tat betroffenen“ Täter zu verfolgen und ihm das Rad mit Gewalt wieder wegzunehmen. Dasselbe gilt für Dr. M, wenn er sich traut, Ralf und Reni mit Gewalt aus dem Strandkorb zu entfernen, ähnlich, wenn die beiden am Tag danach, nachdem die Familie M den Strandkorb wieder übernommen hat und bei schlechtem Wetter nutzt, die Ruhe durch mehrstündige Musik aus einer tragbaren CD-Anlage stören. Dass im Fall 3Ralf, um das Rad wieder zu bekommen, den Holger mit einem Klappmesser angreifen dürfte, wird man dagegen nicht annehmen können.
47
Verbotene Eigenmachtist namentlich in räumlich beengten Verhältnissen, in denen eine ganz ungestörte Nutzung der Sache, besonders auch von Grundstücken, schwierig ist, nicht leicht festzustellen. Der Herausgabeanspruch aus § 861 verlangt zusätzlich, dass der gegenwärtige Besitzer seinem Vorgänger gegenüber „fehlerhaft“ besitzt. Wenn der Besitzer eine Störung nicht hinnehmen muss, kann er sie, wie gezeigt, nach § 859 Abs. 1 oder Abs. 3 selbst beseitigen und hat uU auch einen Schadensersatzanspruch, wenn er für die Beseitigung der Störung Aufwendungen machen musste. Das ist die Lage in dem viel diskutierten Fall des Abschleppens widerrechtlich auf einem privaten Gelände geparkter Fahrzeuge durch ein vom Besitzer des Platzes beauftragten Unternehmer[28]. Was als „Störung“ bei der Verteidigung der Interessen eines Grundstückseigentümers gegen Einflüsse und Einwirkungen aus der Nachbarschaft anzusehen und infolgedessen mit Beseitigungs- und Unterlassungsansprüchen zu bekämpfen ist, ist ähnlich zu beurteilen wie bei der Verteidigung des Eigentums und soll daher dort ( Rn 68 ff) im Zusammenhang dargestellt werden. Festzuhalten ist hier aber, dass durch § 861 der Schutz gegen Wegnahme und Störungen, wie er nach § 1004dem Eigentümer zukommt, auf einen Mieterausgedehnt wird. Wichtig bleibt aber auch hier, dass die schuldrechtliche Lage, gerade auch Ansprüche auf die Sache, in diesem Zusammenhang nicht zum Tragen kommt. Wenn also dem Käufer einer Sache vom Verkäufer die Übergabe der Kaufsache verweigert wird, kann sich der Käufer die Sache nicht mit Gewalt holen; tut er dies, begeht er verbotene Eigenmacht. Eine Ausnahme normiert § 861 Abs. 2 für den Fall, dass der (rechtswidrig) entzogene Besitz dem jetzigen Besitzer gegenüber fehlerhaft war, wenn also im Fall 3Ralf, nachdem Holger mit dem Fahrrad unbemerkt verschwunden war, nach drei Tagen das Fahrrad an eine Parkbank gelehnt findet und an sich nimmt; dann kann die hierin liegende verbotene Eigenmacht von Holger nicht mit Besitzkehr bekämpft werden, der Besitzer soll also nicht dem Anspruch aus § 861 ausgesetzt sein. Zu bemerken ist schließlich, dass die Rechte aus § 859 zur Selbsthilfe auch einem Besitzdiener zustehen, § 860.
Читать дальше